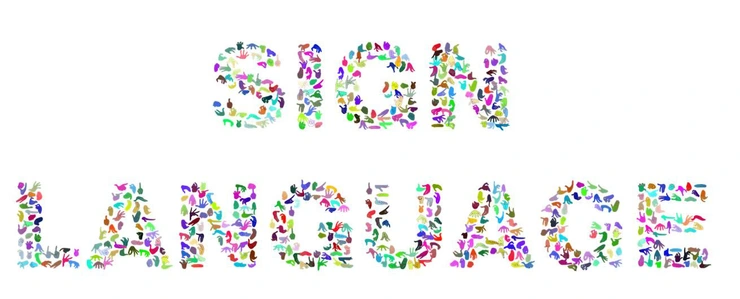"Bis heute gibt es große Vorurteile"
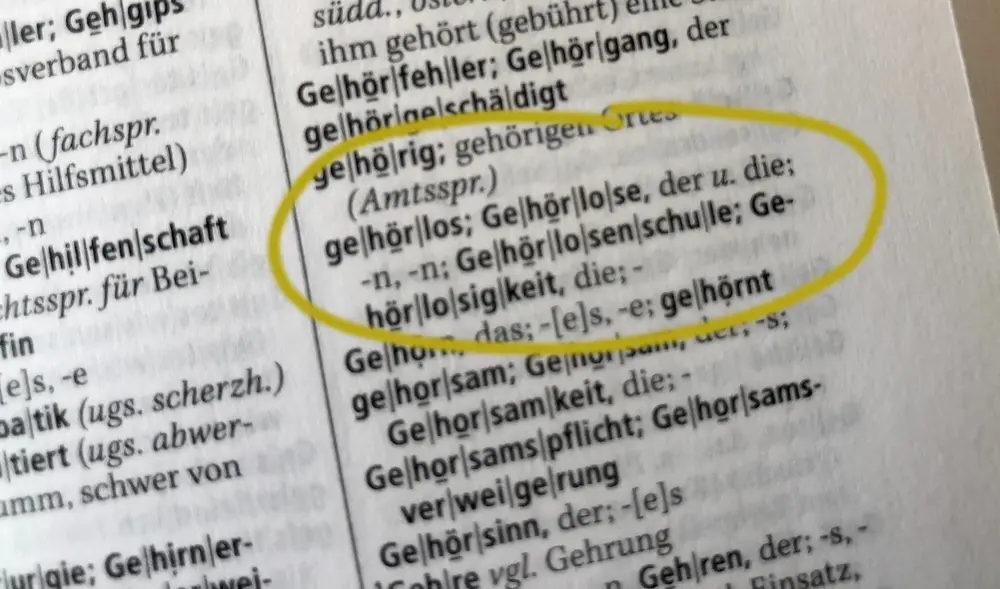
Menschen in aller Welt begehen am 23. September den „Internationalen Tag der Gehörlosen". Er wurde im Jahr 1951 vom Weltverband der Gehörlosen (WFD) ins Leben gerufen und wird seit Mitte der 1970er-Jahre auch in Deutschland begangen. Viele Gehörlosen-Verbände nehmen den Tag zum Anlass, um auf die Situation der bundesweit ca. 80.000 gehörlosen Menschen aufmerksam zu machen und für die Gebärdensprache zu werben. Das Thema gewinnt nicht nur vor dem Hintergrund der Bestrebungen um mehr Diversität an Bedeutung, weiß Dr. Anja Werner, die sich in ihrer Forschung an der Universität Erfurt genau damit beschäftigt. Nach ihrer Beobachtung entwickelt sich der Tag immer mehr zu einem „Internationalen Tag der Gebärdensprache“. Wir haben einmal genauer nachgefragt...
Frau Dr. Werner, warum braucht die Welt einen Internationalen Tag der Gehörlosen??
1951 wurde in Rom (Italien) die World Federation of the Deaf (WFD, Weltverband der Gehörlosen) gegründet, um auf internationaler Ebene in Kooperation mit internationalen Organisationen wie UNESCO und WHO für Rechte und Bildung von Menschen mit Hörverlusten zu kämpfen. Bereits damals führte der WFD den „Internationalen Tag der Gehörlosen“ am 23.9. ein, der sich heute immer mehr zu einem „Internationalen Tag der Gebärdensprache“ entwickelt. 1951 gab es nämlich noch kein Bewusstsein für und fundierte linguistische Kenntnisse über nationaler Gebärdensprachen bzw. unterschiedliche Formen von gebärdeter Kommunikation.
Das erklärt sich wie folgt: Ende des 18. Jahrhunderts wurden in Paris und Leipzig die ersten beiden „Taubstummenschulen“ der Welt gegründet. Damit wurde nicht nur die Gehörlosenbildung institutionalisiert, sondern überhaupt der Grundstein für die Bildung von Menschen, die physisch, psychisch oder sensorisch anders sind als die Mehrheit, gelegt. In Deutschland entstand daraus das heutige Sonder- bzw. Förderschulwesen. Die Pariser Schule machte sich unter Abbé de L’Epée einen Namen als Befürworter der sogenannten „manuellen“ Methode, die Gebärden und Gebärdensprachen im Unterricht nutzt. Die Leipziger Schule begründete unter Samuel Heinicke die „orale“ Methode, die in ihrer „Reinform“ jegliche Nutzung von Gebärden und Gebärdensprache verbot und sich komplett auf den Lautspracherwerb konzentrierte, nämlich Artikulationsübungen und Absehen („Lippenlesen“). Aus dieser Konstellation entwickelte sich ein Methodenstreit, der seit 1780 bis heute in regelmäßigen Abständen mit großer Vehemenz immer wieder neu aufflammte. 1880 setzte sich der inzwischen als „deutsche Methode“ bekannte orale Ansatz auf dem Kongress der „Taubstummenlehrer“ in Mailand (Italien) international durch. In der westlichen Welt begannen Schulen für gehörlose und taube Kinder und Jugendliche nun, Gebärden und Gebärdensprachen mit wenigen Ausnahmen (wie z.B. segregierte Schulen für taube Afroamerikaner:innen in den USA) komplett aus dem Unterrichtsprogramm zu verbannen. Das bedeutete auch, dass taube gebildete Erwachsene nicht mehr an Gehörlosen- und Schwerhörigenschulen unterrichten konnten. Sie wurden von hörenden Lehrenden von diesem Arbeitsmarkt verdrängt. Nicht nur im nationalsozialistischen Deutschland wurden als erblich krank stigmatisierte taube Menschen zu Tausenden zwangssterilisiert. Man geht davon aus, dass allein im „Dritten Reich“ etwa 16.000 hörgeschädigte Menschen zwangssterilisiert wurden. Die Aufarbeitung und Anerkennung dieser Verfolgung dauert bis heute an.
Erst seit den 1950er-Jahren entwickelte sich eine akademisch angebundene Gebärdensprachforschung als Zusammenarbeit von tauben und hörenden Fachleuten. Die erste Studie zu einer nationalen Gebärdensprache wurde 1960 von dem US-Amerikaner William Stokoe an der Gallaudet University in Washington, DC (USA) vorgelegt. In Deutschland setzte die Forschung, angestoßen von Siegmund Prillwitz, zögerlich in den frühen 1970er-Jahren an der Universität Hamburg ein. Seit den 1970er-Jahren kann man von einer internationalen Deaf Rights Bewegung sprechen, wobei „Deaf“ mit großgeschriebenem Anfangsbuchstaben für eine sich ihrer kulturellen Bedeutung bewussten, eine nationale Gebärdensprache nutzende Gehörlosengemeinschaft steht. In Deutschland wurde erst 1985 eine erste Grammatik der Deutschen Gebärdensprache (DGS) veröffentlicht. Seither spricht man in Deutschland von der DGS als eigener visueller Sprache in Abgrenzung von anderen gebärdeten Kommunikationssystemen, die der Grammatik der deutschen Lautsprache folgen. Bis heute wird die Gebärdensprache noch nicht flächendecken in allen Hörgeschädigtenschulen der Bundesrepublik genutzt. Doch auch wenn hörgeschädigte Kinder und Jugendliche heute mit digitalen Hörhilfen und Hörprothesen wie Cochlea Implantaten (CI) individuelle Hörerlebnisse haben und dadurch Lautsprache verstehen können, werden sie dadurch nicht „normalhörend“. Sie bleiben auch sichtbar anders und stoßen immer wieder an kommunikative Grenzen. Deshalb gibt es auch heute noch immer kaum hörbeeinträchtigte Studierende und Dozierende an deutschen Universitäten.
Gebärdensprachen ermöglichen es Personen mit Hörverlust, natürlich zu allen Themen ohne Einschränkungen zu kommunizieren. Ihr Verbot stellt eine Verletzung der Menschenrechte hörgeschädigter Personen dar, nämlich das Recht auf eine natürliche Muttersprache. Daher brauchen wir einen internationalen Tag der Gebärdensprache bzw. der Gehörlosen, um darauf aufmerksam zu machen, was gehörlose Menschen leisten können, wie vielseitig Kommunikation auch in unterschiedlichen Modalitäten (gesprochen oder gebärdet) ist, und dass auch hörende Menschen einen Beitrag leisten können, Kommunikation auf all diesen Ebenen zu realisieren.
Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren wissenschaftlich mit den Perspektiven sprachlich-kultureller Minderheiten: Was genau ist dabei Ihr Forschungsgegenstand?
Seit 2004 beschäftige ich mich mit der Geschichte tauber Menschen als transkulturelle Geschichte. Damals arbeitet ich an meiner Dissertation über US-Amerikaner*innen an deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert und stieß durch Zufall auf drei hörgeschädigte. 2019 gab ich gemeinsam mit Marion Schmidt, PhD von der Medizingeschichte in Göttingen, einen Sammelband über Gehörlosengeschichte im deutschsprachigen Raum mit Beiträgen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz heraus. Daraus entwickelte sich für uns eine längerfristige Zusammenarbeit in Kooperation mit Interessenvertretungen gebärdensprachlich tauber und lautsprachlich schwerhöriger Menschen in den drei Ländern. Seit 2020 haben wir ein von der DFG gefördertes Netzwerk zur Gehörlosengeschichte im deutschsprachigen Raum und bieten regelmäßig online sprachlich barrierefrei Workshops zur Deaf History mit Gebärdensprachdolmetschenden und Schriftdolmetschenden an. Da es auch unser Ziel ist, taube und schwerhörige Historiker*innen zu fördern und vernetzen, bieten wir zunehmend auch Diskussionsrunden und Aktivitäten zum Abbau von Barrieren in der historischen Forschung und Geschichtsvermittlung an Hochschulen an.
An der Universität Erfurt haben wir gemeinsam mit Prof. Sabine Schmolinsky, Prof. Christiane Kuller, Juliane Wenke (MA) und Paula Mund (BA) im SoSe 2021 eine Arbeitsgruppe zum Abbau von Barrieren am Historischen Seminar ins Leben gerufen. Wir sind auch mit dem Diversitätsbeauftragten in Kontakt. Ein erstes Ergebnis war im Sommersemester 2022 ein gemeinsam von hörenden und hörgeschädigten Studierenden, Promovierenden und Lehrenden veranstaltetes barrierearmes Lehrangebot im Studium Fundamentale.
Unsere wichtigste Erkenntnis war: Alle profitieren, wenn man beginnt, sich aktiv mit kommunikativen Barrieren Betroffener auseinanderzusetzen und dabei Ideen diskutiert, wie das passieren kann."
Diese praktische Seite meiner Forschung war eine Notwendigkeit, denn ich kann nicht historisch forschen, ohne mit tauben und schwerhörigen Zeitzeug*innen aber auch Kolleg*innen in einen Austausch zu treten.
Sie haben sich auch in Ihrer gerade abgeschlossenen Habilitationsschrift mit dem Thema beschäftigt – welche Erkenntnisse haben Sie darin bezüglich Ihrer Forschungsfrage gewinnen können?
Dass ich an der Universität Erfurt mit einer Arbeit zur Deaf History habilitieren kann, verdanke ich Prof. Jürgen Martschukat und Prof. Christiane Kuller. Es gibt in Deutschland im Gegensatz zu anderen westlichen Ländern bis heute keine institutionalisierte Deaf History. Meine Arbeit ist deutschlandweit die erste Habilitationsschrift zu diesem Thema überhaupt und leistet somit auch methodische Grundlagenarbeit. In meiner Habilitationsschrift habe ich Deaf History als Wissenschaftsgeschichte am Beispiel internationaler Einflüsse auf Fachdiskurse über Taubheit im geteilten Deutschland unter Einbeziehung der Sichtweisen tauber und schwerhöriger Akteur*innen untersucht.
Seit 1. Juli 2022 bin ich nun mit einem neuen Projekt am Campus Gotha der Universität Erfurt am Forschungskolleg Transkulturelle Studien / Sammlung Perthes bei Prof. Iris Schröder angebunden. Darüber hinausgehend stehe ich im engen Austausch mit Prof. Martschukat und Prof. Kuller. Ich erforsche „Schwarze und taube westliche Missionare und Gehörlosenbildung in Ghana und Nigeria: Leben und Werk von Berta und Andrew Foster“ in einer globalgeschichtlichen Fallstudie. Berta Foster war eine taube deutsche Frau, die 1959 auf dem 3. Weltkongress der Gehörlosen in Wiesbaden ihren zukünftigen Ehemann, den tauben afroamerikanischen Missionar Andrew Foster kennenlernte, der 1957 bereits eine Schule für taube Menschen in Ghana gegründet hatte. Gemeinsam gründeten sie mehr als 30 Schulen und Kirchen für taube Menschen in 13 afrikanischen Ländern. Berta kehrte dem oralistisch ausgerichteten Deutschland den Rücken, um in Afrika und den USA neue Freiheit mit gebärdetem Englisch zu erleben. Die Foster-Familie, zu der letztlich fünf hörende Kinder zählen, pendelte zwischen den Kontinenten und kam auch regelmäßig nach Deutschland, um Bertas Familie in (West-)Berlin zu besuchen und Spenden für die Mission in Afrika zu sammeln. Berta führte die Mission nach Andrews Unfalltod im Jahr 1987 mit eigenen Schulgründungen beispielsweise auf den Fidschi-Inseln fort. Sie starb 2018 in Texas (USA).
Wie kamen Sie zu diesem Forschungsthema?
Als ich zwischen 2002 und 2006 an der Universität Leipzig an meiner Dissertation über US-amerikanische Studierende an deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert arbeitete (The Transatlantic World of Higher Education, Berghahn Books, 2013), stieß ich durch Zufall auf drei Studierende mit Hörschädigung, darunter eine Frau. Ich dachte damals noch naiv, „wie wunderbar, dass Hörschädigung schon damals kein Problem für höhere Bildung darstellte“, wunderte mich aber gleichzeitig, warum ich auf dem Campus nie tauben oder schwerhörigen Studierenden und Fakultätsangehörigen begegnete. Mein Interesse war geweckt. Ich begann die Situation in Vergangenheit und Gegenwart zu recherchieren und verfasste 2004 einen ersten Artikel über das Studium mit Hörschädigung in Leipzig. Von da an ließ mich das Thema nicht mehr los. Während einer Konferenz am Deutschen Historischen Institut in Washington, DC (USA) lernte ich den tauben Historiker Dr. Joseph Murray kennen – er war damals noch Doktorand, heute ist er der Präsident der World Federation of the Deaf. Er nahm mich mit zur Gallaudet University, der weltweit einzigen Universität für taube Studierende, an der zweisprachig in Englisch und American Sign Language (ASL) geforscht und gelehrt wird. Es ist ein einzigartiger, barrierefreier Campus auch für Menschen mit anderen Formen von Behinderungen. Dort ermutigte man mich, zur Geschichte tauber Menschen in Deutschland zu forschen, weil das sonst niemand macht. Mit meiner Arbeit versuche ich auch aufzuzeigen, wie am Beispiel der Geschichte gehörloser und schwerhöriger Menschen unterschiedliche interdisziplinäre Forschungsansätze in transkulturellen Kontexten realisiert werden können.
Inwieweit ist Ihre Arbeit für die Gesellschaft relevant? Oder anders gefragt: Was können wir aus Ihrer Arbeit lernen?
Der erste gebärdensprachlich taube Präsident der Gallaudet University in Washington DC sagte einmal, „Deaf people can do anything except hear“. Ich habe im Laufe der Jahre im Zuge meiner Recherchen viele gebärdensprachlich als auch lautsprachlich kommunizierende taube und schwerhörige Menschen kennengelernt.
Ich bin immer wieder von neuem beeindruckt, was diese Menschen im Alltag und in der Forschung leisten."
Eine meiner wichtigsten Erkenntnisse ist: Bei Hörverlust geht es letztlich gar nicht um Hören, es geht um Kommunikation. Eine Hörschädigung beeinflusst das Vermögen der Betroffenen, wie die hörende Mehrheit lautsprachlich zu kommunizieren. Sie können das aber auf verschiedenen Wegen exzellent kompensieren, wenn man ihnen Raum hierfür gibt. Das ist bis in die jüngste Vergangenheit und teilweise auch heute noch nicht der Fall. Ursachen und Folgen dieser Unterdrückung sind bis heute nicht systematisch aufgearbeitet. Bis heute gibt es große Vorurteile. Aufgrund der in Deutschland besonders starken oralistischen Tradition, werden taube und schwerhörige Menschen hier noch immer fast ausschließlich als „behindert“ von der mehrheitlich hörenden Gesellschaft wahrgenommen. Dabei sind sie aktive Akteur*innen, die unsere Gesellschaft nicht nur kommunikativ sehr bereichern, sondern oft nahezu unsichtbar auch aktiv mitgestalten. Ich würde mir wünschen, dass wir zukünftig mehr auf die Menschen und ihre Möglichkeiten schauen und gemeinsam behindernde Barrieren abbauen. Diese Arbeit wird bisher in Deutschland noch zu sehr allein den Betroffenen überlassen.