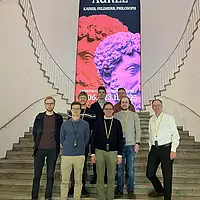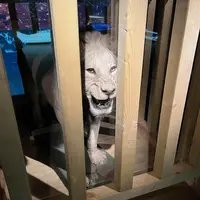Rund um die Professur der Alten Kirchengeschichte, Patrologie und Christlichen Archäologie stehen Forschung und Aktivitäten niemals still. Auf dieser Seite finden Sie einen Überblick über die aktuellen Promotions- und Habilitationsprojekte, wie auch über die abgeschlossenen Dissertationen und Magisterarbeiten. Des Weiteren erhalten Sie einen Einblick in die vielfältigen Exkursionen und Tagungen, welche im Rahmen der Alten Kirchengeschichte stattgefunden haben.
In dem Projekt soll der ureigene christliche Beitrag bzgl. Unterricht, Erziehung und Bildung junger Menschen vorgestellt werden, wie er v.a. zwischen 200 und 400 erarbeitet und auch innerkirchlich teils nachdrücklich diskutiert wurde. Aus welchem Fundus der christlichen Glaubenswelt (vor dem Hintergrund eines entsprechenden Menschenbildes) speiste er sich? Worauf gründete es sich, dass in deutlich mehr als defensiv-apologetischer Weise etwa seit Anfang des 3. Jahrhunderts christliche Vordenker wie Klemens v. Alexandrien oder Origenes inmitten der paganen Intellektuellenwelt und ihrer zu großen Teilen neuplatonischen Prägung diesen Beitrag mitunter recht selbstbewusst vertraten? Das wiederum setzt ein Verständnis dafür voraus, was man zu diesem Zeitpunkt in jenen Kreisen überhaupt unter «Bildung» (paideίa) verstand. Gab es ein «Depositum», das über Jahrhunderte als tradierenswert weitergeben wurde? Aus historischem Blickwinkel wird daraufhin summarisch der Frage nachgegangen, inwieweit schon in der paganen Gesellschaft so etwas wie «Unterrichtskonzepte» oder «Lehrpläne» mit einem festen inhaltlichen Grundbestand per se in Geltung waren, ob es einen Fächerkanon gab, der als verbindlich oder wenigstens konsensfähig anerkannt wurde. Ein Schwerpunkt besteht im Folgenden darin, zu prüfen, zu welcher Art von Modifikationen bzw. Neujustierungen auf bildungstheoretischer und -praktischer Ebene es v.a. in der sog. reichskirchlichen Zeit ab der Mitte des 4. Jh. n. Chr. innerhalb der Patristik kam (paideia Christi). Welche Auswirkungen hatte das gewandelte Gottesbild auf die Vorstellungen von der Bildsamkeit des Menschen (doctrina christiana)? Nahm der christlich gewordene Staat Einfluss auf die Ausrichtung der schulischen Angebote? Inwieweit wurde auf dem Felde von Schule und Unterricht von Seiten christlicher Pädagogen (freilich zu verstehen im weiteren Sinne) originär Neues entwickelt? Wie sehr mussten sie (nolens oder volens?) auf die vorliegende pagane Tradition rekurrieren? Und: Nahmen Vertreter aus den Reihen der Altgläubigen es so ohne weiteres hin, wenn sich christliche Autoren selektiv und im Sinne eines propädeutischen Nutzbarmachens an diesem, sofern man es so nennen darf, kanonischen Wissensrepertoire bedienten - und sei es nur in methodischer Hinsicht.
Der Kirchenvater Gregor von Nazianz (etwa 329-390) war nicht nur ein herausragender Redner, sondern hat der Nachwelt auch über 2000 Verse christliche Dichtkunst hinterlassen.
In seinen Carmina dogmatica verarbeitet der Kappadokier essenzielle theologische Lehren, welche vor allem die Trinität und die Christologie betreffen, sowie biblische Inhalte in einer einzigartigen und attraktiven Weise, indem er den bekannten Glauben in kunstvolle Verse bringt. Darüber hinaus beinhalten die Dogmatischen Gedichte diverse Gebete und Hymnen, die sich durch theologische Fülle, zahlreiche biblische Anspielungen und sprachliche Gewandtheit auszeichnen.
Trotz seiner Bedeutung und Attraktivität wartet dieses einmalige Werk des großen Kirchenvaters noch immer auf eine wissenschaftliche Edition, die dem Forschungsstand der jüngeren Zeit entspricht und einen möglichst großen Umfang an Handschriften berücksichtigt. Dieser Lücke in der patristischen Forschung soll durch das hier vorgestellte Projekt abgeholfen werden, welches zudem einen Kommentar sowie eine (erstmalige) Übersetzung der Gedichte ins Deutsche bieten soll.
Eusebius, Bischof von Vercelli im heutigen Piemont, gehörte zu einer Reihe exponierter Bischöfe in der Kirche des 4. Jahrhunderts. Er nahm im Laufe seines kurzen überregionalen kirchenpolitischen Wirkens an verschiedenen Synoden teil: Auf der Synode von Mailand im Jahre 355 wandte er sich gegen die Anordnung des Kaisers Konstantius II., Athanasius von Alexandria zu verurteilen, und weigerte sich, im Sinne der Interpretatio Luciferiani (d.h. der auf Lucifer von Calaris in Korrespondenz mit dem römischen Bischof Liberius zurückgehenden Deutung, es handele sich bei dieser Verurteilung nicht bloß um einen Disziplinarfall, sondern mit Athanasius als prominentestem Verfechter des Konzils von Nizäa solle dieses und sein Glaubensbekenntnis im Ganzen verurteilt werden) das nicänische σύμβολον zu verleugnen, womit er letztlich die Exilierung in Kauf nahm, die ihn über Palästina und Kappadokien in die oberägyptische Thebais führte.
Nach der Rückkehrerlaubnis durch den neuen Kaiser Julian verhandelte er auf der Synode von Alexandria 362 gemeinsam mit Athanasius u.a. den Umgang der Kirche mit denjenigen, die mit dem forcierten Arianismus unter Konstantius II. sympathisiert oder unter dem Druck der Behörden nachgegeben hatten, und reiste in der Folge persönlich nach Antiochia, um der dortigen Kirche die synodalen Beschlüsse – den sog. Tomus ad Antiochenos – zu überbringen. Der damit verbundene Versuch einer Versöhnung und des Schmiedens einer nicänischen Allianz scheiterte jedoch, nachdem kurz zuvor Lucifer von Calaris den Presbyter Paulinus zum antiochenischen Bischof gegen die bereits konkurrierenden Bischöfe Euzoius und Meletius geweiht hatte und somit die Gräben in Antiochia weiter vertiefte, sodass Eusebius schließlich nach Vercelli zurückkehrte, wo er 371 starb.
Die Studie beschäftigt sich mit den Synoden unter Beteiligung des Eusebius. Gleichzeitig handelt sie von seiner Person und seinem Verhältnis zu den Synoden. Bspw. werden Fragen beantwortet wie: Welche Rolle spielt er dort? Wie positioniert er sich hinsichtlich verschiedener Themen und Problemstellungen? Welche legt Politik er an den Tag? Wie gestaltet sich das Verhältnis und die Dynamik zwischen den Akteuren? Somit leistet die Studie „‚Den Häretikern ein Häretiker‘ (Max. Taur. Serm. VII). Eusebius von Vercelli und die ihn betreffenden Synoden“ einen Beitrag zur Synodalgeschichte des 4. Jahrhunderts, welche sie anhand eines exponierten Bischofs darlegt.
Die COVID-19-Pandemie hat dem Menschen in den vergangenen Jahren seine eigene Verwundbarkeit gegenüber der Natur und durch Krankheiten erneut schmerzlich vor Augen geführt. Die dynamische und komplexe Lage, die diese neue Erkrankung mit sich brachte, war für unsere moderne Gesellschaft zunächst überraschend, ungewohnt und für die meisten mit bislang ungekannten Härten verbunden, obwohl Pandemien sicherlich kein historisches Novum darstellen, sondern fest im kollektiven Gedächtnis der Menschheit verankert sein sollten. Denn seit jeher hatten die Menschen mit Krankheiten und Seuchen zu kämpfen, deren berüchtigtste Vertreter als „Schwarzer Tod“, „Spanische Grippe“ oder nun eben „COVID-19“ in die Geschichte eingingen.
Weniger bekannt, aber nicht minder dramatisch, stellte sich die sogenannte „Cyprianische Pest“ dar, eine schwere Infektionskrankheit, die ungefähr in der Mitte des dritten Jahrhunderts ausgehend von den Rändern des Imperiums binnen weniger Jahre beinahe das gesamte römische Reich heimsuchte und dabei zahllose Todesopfer forderte. Benannt ist diese pandemische Erkrankung nach dem frühchristlichen Theologen Cyprian von Karthago, der in jenen Jahren der Pandemie der Gemeinde von Karthago als Bischof vorstand und von dem die ausführlichste Schilderung der todbringenden Seuche überliefert ist. Im Angesicht von Krankheit, Tod und Leid bestand seine Aufgabe als Bischof darin, den Glauben seiner Gemeinde an die christliche Hoffnungsbotschaft trotz zunehmender Zweifel der Gläubigen aufrechtzuerhalten. Diese hatten nämlich erkannt, dass der grausige Tod nicht nur Heiden, sondern eben auch zahlreiche Christen hinwegraffte, obwohl ihnen doch von der neuen Religion das ewige Leben in Christus versprochen worden war. Zur Ermutigung seiner Gemeinde in dieser eher unwirtlichen Lage verfasst nun Cyprian den Traktat de mortalitate, der nicht nur eine eindrückliche Schilderung der problematischen Situation, in der sich die Menschen befanden, umfasst, sondern der ganz allgemein das Problem der Sterblichkeit des Menschen unter den Bedingungen der Welt thematisiert. Dabei geht der Bischof von Karthago nicht zuletzt auf die Bedeutung des Todes für den Christen ein, denn nach Ansicht Cyprians könne für einen konsequent gläubigen Christen der Tod keinen Schrecken darstellen, führe er letztlich doch nur dorthin, wo der Christ sein eigentliches Zuhause wähnt: bei Gott. Dies wird nicht nur argumentativ auf verschiedene Weise dargestellt, sondern auch von zahlreichen biblischen Beispielen untermauert und in eine literarische Form gegossen, die sowohl eine paränetische Struktur aufweist als auch der antiken Form der Trostschrift nicht unähnlich ist.
Ziel der Studie ist es nun, den an dieser Stelle nur kurz skizzierten Traktat Cyprians zunächst neu und vor allem zielsprachenorientiert ins Deutsche zu übertragen und anschließend mit einem ausführlichen philologisch-theologischen Kommentar zu versehen, der versuchen wird, sowohl die literarische Form als auch den theologischen Sinngehalt dieses spannenden Textes zu heben und dadurch gegebenenfalls weitere Forschung zu diesem Werk Cyprians zu ermöglichen.
Ausgangspunkt zu diesem Versuch einer Kommentierung von Tertullians kleiner Schrift de ieiunio ist deren Doppelbödigkeit: Gezeigt werden soll, dass sie in ihrer sprachlichen Dimension wie die Predigt einer rigoristischen Praxis klingt und in diesem Rigorismus die kirchliche Hierarchie und ihre Sympathisanten gnadenlos angreift. Dahinter bleiben die inhaltlichen Unterschiede zwischen der montanistischen und der Praxis der von Tertullian verächtlich als "Psychici" bezeichneten Mitglieder der Großkirche weit zurück. Wie es Tertulllian manchmal nachgesagt wird, scheint er hier in seiner Kritik beinahe maßlos, gerade weil diese praktischen Unterschiede eigentlich gering waren. Daher kann eine neue Kommentierung, indem sie diese Diskrepanz nachweist, vielleicht zeigen, dass es Tertullian eher um die nach wie vor aktuelle Frage geht, mit welchem Recht jemand bestimmt, wie man zu leben hat.
Kaum ein anderes Thema findet innerhalb der Altertumswissenschaften seit jeher eine ähnlich intensive Beschäftigung wie das bezüglich der sog. konstantinischen Wende. Konstantins Motivation für eine Förderung des Christentums, das zuvor meist Gegenstand von Verfolgungen und Unterdrückung gewesen war, ist dennoch bis heute nicht eindeutig geklärt. Immer wieder wird in der Forschung diskutiert, ob es im Umfeld des Kaisers Konstantin d. Großen Christen gegeben haben könnte, die auf ihn Einfluss gewonnen und auf diese Weise seine Hinwendung zum Christentum vorbereitet haben könnten. Ein Name, der hierzu in der jüngeren, v. a. in der englischsprachigen, Forschung immer wieder genannt wird, ist der christliche Schriftsteller Laktanz (ca. 250–325).
Ausgehend vom gesamten literarischen Œuvre des anfangs heidnischen und später christlichen Rhetorikprofessors Laktanz verfolgt die Studie das Ziel, Erkenntnisse zur Beschaffenheit der Beziehung bzw. des Verhältnisses zwischen dem christlichen Schriftsteller und Konstantin dem Großen gewinnen zu können. Im Zusammenhang damit wird ebenfalls die grundlegende Frage diskutiert, inwiefern Laktanz während der Phase der ›Konstantinischen Wende‹ eine Vermittlerrolle zwischen der heidnischen und der christlichen Kultur sowie Glaubenswelt spielt und durch seine Verwurzelung in beiden Denk- und Sprachwelten als Brückenbauer in eine neue Ära betrachtet werden kann.
Neben den klassischen literatur- bzw. sprachwissenschaftlichen und historischen Methoden verwendet die vorliegende Studie den ›Framing-Ansatz‹. Dieser bezieht sich auf die Art und Weise, wie Informationen präsentiert werden, um die Wahrnehmung und Interpretation eines Themas zu beeinflussen. Es umfasst die bewusste Auswahl bestimmter Worte, Begriffe oder Perspektiven, um eine bestimmte Sichtweise zu fördern oder zu verstärken. Durch das Framing können Kommunikatoren wie Laktanz Einfluss auf die Meinungsbildung und Reaktionen des Publikums nehmen, indem sie die Rahmenbedingungen für die Darstellung von Informationen festlegen.
Die Studie macht wahrscheinlich, dass es dem christlichen Rhetor am kaiserlichen Hof gelungen ist, dass sein christliches Framing vom Kaiser aufgenommen und in dessen eigenen literarischen Zeugnissen ›remedialisiert‹ wurde. Dadurch lässt sich nachweisen, dass Laktanz’ strategische Kommunikation eine Wirkung außerhalb christlicher Kreise erzielte, was bis dahin noch kein lateinischsprachiger Apologet von sich hätte behaupten können: Ihm gelang es nachweislich als erstem christlichen Autor, mit seinen apologetisch-protreptisch ausgerichteten Schriften von einem römischen Kaiser gelesen und aufgegriffen worden zu sein. Somit erreichte es Laktanz, über Konstantin in den öffentlichen Diskurs vorzudringen und das Christentum darin als ernstzunehmenden Faktor zu etablieren.
Er ist somit das Bindeglied der ausgehenden Antike und der beginnenden Spätantike, was sich mitunter auch in seinem literarischen Erbe zeigt. Er durchbricht die Mauern zwischen paganen Bildungstraditionen und christlicher Abwehrhaltung und forciert einen politischen Diskurs, ja einen Kampf um die Deutungshoheit am kaiserlichen Hof Konstantins, ohne dabei eine ›gleichwertige‹ Synthese zu behaupten, nach der das Christentum gleichberechtigt neben der nichtchristlichen Umwelt stehen würde.
Hier geht's zur Dissertation “Christliches Framing einer römischen Welt.”
In seinem Traktat de fuga in persecutione bezieht der frühchristliche Theologe Tertullian v. Karthago (ca. 160–220 n. Chr.) Stellung zur Frage, ob es für Christen erlaubt sei, in der Verfolgung zu fliehen. Seine ebenso von der klassischen Rhetorik wie der stoischen Philosophie und dem Kontakt zum Montanismus beeinflusste Argumentation kommt zu einem klaren Ergebnis: Einzig Standhaftigkeit und Martyriumsbereitschaft können die rechte Antwort auf die Verfolgung sein. Die vorliegende Studie bietet eine Einleitung, Übersetzung und umfassende Kommentierung dieser Schrift und versucht, sie mittels eines multiperspektivischen Ansatzes im historischen und theologischen Kontext ihrer Zeit auszulegen.
Das Hohelied gilt als wichtiger Fundus der Sprache sowie Theologie vieler christlicher Autoren und Mystiker, die ihre persönlichen Erfahrungen mit Gott schildern. Dieser Band schlägt einen Bogen von der Hoheliedauslegung des antiken Theologen Origenes (185–254) zu den Hoheliedpredigten des mittelalterlichen Zisterzienserabtes Bernhard von Clairvaux (ca. 1090–1153), deren Abhängigkeit von Origenes als gesichert gilt. Die Studie legt den Fokus auf Elemente der Gottesbegegnung und arbeitet Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede zu ausgewählten Motiven und anthropologische Grundvoraussetzungen heraus. Sie zeigt, dass Origenes, als Wissenschaftler der Frühen Kirche, die Gottesbegegnung mittels der Erkenntnisfähigkeit des Menschen ermöglicht sieht, während Bernhard von Clairvaux, als charismatischer Ordensgründer, den Affekt als Mittel und Zentrum der Gottesbegegnung betrachtet.
Das Buch "Honigtrank des Origenes und Balsam des seligen Bernhards. Gottesbegegnung im Hohelied."
Diese Studie wurde als beste Abschlussarbeit mit dem Preis des Freundeskreises der Katholisch-Theologischen Fakultät Erfurt ausgezeichnet (15.11.2018).
Am 1. September 256 traten in Karthago 85 nordafrikanische Bischöfe zu einer Synode unter der Leitung Cyprians zusammen, um ihre Position innerhalb des Streits um die Taufe durch Häretiker und Schismatiker – auch bekannt als „Ketzertaufstreit“ – kundzutun. Festgehalten in den Sententiae episcoporum LXXXVII de haeriticis baptizandis (Sentenzen der 87 Bischöfe über die zu taufenden Häretiker) demonstrierten sie ihre Einmütigkeit, indem ein jeder von ihnen konstatierte, die außerhalb der Catholica gespendete Taufe sei ungültig. Insofern solle an jedem häretischen Konvertiten, der nicht zunächst in der Catholica getauft wurde, später abgefallen war und nun zurückkehrte, die Taufe vollzogen werden. Weil dies aber von Kritikern – insbesondere dem römischen Bischof Stephan – als „Wiedertaufe“ aufgefasst wurde, entwickelte sich ein großer Streit zwischen der römischen und der karthagischen Kirche, deren Höhepunkt auf karthagischer Seite die Synode vom Spätsommer 256 darstellte.
Die Studie „Einheit und Verständigung in der Kirche des 3. Jahrhunderts? Die Synode vom Spätsommer 256 in Karthago“ handelt sowohl von den Voraussetzungen des Streits als auch von der Biografie Cyprians sowie seiner Relevanz für den Verlauf des Streits und für das damit verbundene synodale Geschehen. Darüber hinaus stellt sie differenziert die Synode selbst dar, d.h. Teilnehmer, Verlauf, Theologie und Rezeption. Und schließlich wird auf Basis dieser Erkenntnisse die Frage nach Einheit und Verständigung in der Kirche des 3. Jahrhunderts beantwortet unter der gleichzeitigen Perspektive, wie unterschiedliche Blickwinkel die Bewertung dieser Frage verändern.
Die Sonne ist alltäglicher Bestandteil der Erfahrungswelt. Sie ist daher universeller Bezugspunkt menschlicher Religiosität und Untersuchungsgegenstand für die Religionsgeschichte. Dabei darf von Gemeinsamkeiten nicht auf Abhängigkeiten geschlossen werden. Auch finden sich von der Antike bis heute Bemühungen, Kontinuitätslinien zu konstruieren und Elemente zu historisieren.
Die Verehrung des Sonnengottes und des Christengottes standen sich nah, was in der Religionspolitik Konstantins ihren Höhepunkt fand. Dieser Umstand wirft die Forschungsfrage auf, welche Rolle dem Sol invictus bei der Etablierung des Christentums zukam. Die Studie möchte das Christentum und den Sonnenkult nebeneinander in den Blick nehmen. In diesem Zusammenhang sollen auch die vielfältigen Phänomene und Sonnenbezüge betrachtet werden, die mit dem Christentum und der Sonnenverehrung einher gingen. Die Arbeit ist anhand inhaltlicher Diskursebenen gegliedert, welche sich aus der Thematik und der Quellenlage ergeben.