Tagungen
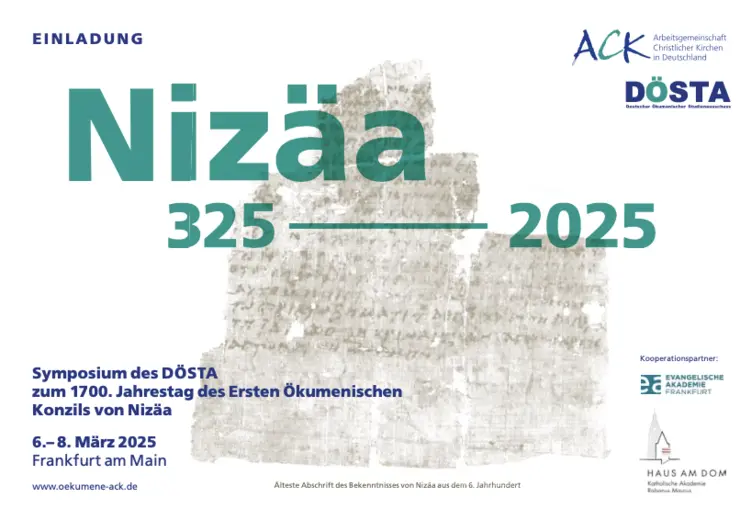
Nizäa 325–2025: Symposium des DÖSTA zum 1700. Jahrestag des Ersten Ökumenischen Konzils von Nizäa
06. - 08. März 2025 Frankfurt am Main
2025 kann die Christenheit den 1700. Jahrestag des Konzils von Nizäa begehen, des Ersten Ökumenischen Konzils in der Geschichte der Kirche, das im Jahre 325 n.Chr. stattgefunden hat. Obwohl es damals so wenig wie heute eine in sich homogene Kirche gab, zeigt das Konzil mit seinen Beschlüssen das normative Idealbild einer einzigen, organisatorisch geeinten, in Lehre und Praxis einheitlichen und in diesem Sinn ökumenischen Gesamtkirche. Das Symposium berücksichtigt die vielfältigen Aspekte des Konzils und seiner Rezeption in ihrer Breite, um auszuloten, welche Bedeutung die Erinnerung an das Nizänum für unsere aktuellen gesellschaftlichen, kirchlichen und ökumenischen Kontexte haben kann.
Das Symposium wird veranstaltet vom Deutschen Ökumenischen Studienausschuss (DÖSTA), dem akademischen Ausschuss der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) in Kooperation mit der Evangelischen Akademie Frankfurt und der Katholischen Akademie Rabanus Maurus im Haus am Dom Frankfurt.

Gottes starke Töchter - Frauen und das Amt im Katholizismus
18.-19. September 2023 Propstei St. Trinitatis Leipzig und im Stream
Internationale Hybrid-Konferenz
Die Frauenfrage ist die Zukunftsfrage der katholischen Kirche. Ihre bisherige Antwort
ist zu einem Glaubwürdigkeitsproblem geworden. Denn man kann nicht die Würde
des Menschen verteidigen und zugleich Frauen gleiche Rechte verweigern. Die Rück-
meldungen zur Weltsynode zeigen: Katholikinnen und Katholiken auf der ganzen Welt
erwarten und fordern auch in ihrer Kirche Geschlechtergerechtigkeit.
Welche Rollen, Aufgaben und Ämter werden Frauen künftig in der Kirche einnehmen?
Welche strukturellen Grenzen und Denkblockaden sind zu überwinden, welche Heraus-
forderungen sind zu meistern?
"Widerständige Offenbarung". Jahrestagung der AG Dogmatik/Fundamentaltheologie
11.-13. September 2023, Haus am Dom, Frankfurt/M.
Welche Vorstellungen, welche Dimensionen verbinden sich mit dem Konzept Offenbarung – mit Blick auf seine alltagsästhetischen Ausfransungen und semantischen Unschärfen? Wie lässt sich rational belastbar von einer Offenbarung Gottes sprechen – nicht zuletzt vor dem Hintergrund fundamentalistischer Offenbarungspolitiken? Was bedeuten die konkurrierenden Offenbarungsansprüche der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften? Wenn Menschen von einer Offenbarung Gottes reden, bleibt es nicht bei einem reinen Konstrukt? Wie verhalten sich die interpretativen Einträge der Rede von einer Offenbarung zu ihrem Wirklichkeitsbezug?
Die Jahrestagung 2023 der AG katholischen Dogmatik/Fundamentaltheologie im deutschen Sprachraum widmet sich diesen Fragen. Sie soll mit dem Leitmotiv einer „widerständigen Offenbarung“ den Problemgehalt, aber auch das unverzichtbare Moment einer theologischen Figur zur Geltung bringen, das die christliche Rede von Gott anleitet: über die Heilige Schrift wie die kirchliche Traditions- und Lehrentwicklung. Politisch-theologische, kulturelle und epistemologische sowie diverse Bruchmomente bilden den Horizont, vor dem wir über das Konzept „Offenbarung“ ins Gespräch treten möchten.

Synode als Chance. Was Kirche braucht – damit Sie weitergeht
01.-03. Juni 2023 Katholische Akademie Domschule Würzburg
Der Synodale Weg in Deutschland hat polarisiert wie kaum ein anderes Kirchenereignis der letzten Jahre. Die einen sehen ihn als kirchenrechtliche Luftnummer, die anderen als Form einer dringend notwendigen Weiterentwicklung. Dabei hat allein die Fülle der Themen und Erwartungen gezeigt: Die Kirche steht vor immensen Herausforderungen. Die Taktik, ein- fach auf Zeit zu spielen, wird nicht aufgehen. Zu bedrückend sind die Missbrauchsfälle, zu starr sind Hierarchien und Männerfixierung, zu entfernt ist Kirche aus dem Alltag der Menschen, zu groß ist der Mitgliederschwund. Was tun?
Synode als Chance: Synoden sind wichtige Formen, um Antworten auf Kirchenfragen zu finden. Dass Menschen zusammenkommen und um Inhalte ringen, ist besser als jedes Schweigen. Doch was trägt dazu bei, dass eine Synode wirklich Ergebnisse erzielt? Wie wichtig sind Räume, Zeiten, Sitzordnungen, Rederechte, Geschäftsordnungen, Öffentlichkeit, informelle Treffpunkte usw., damit Synode klappt? Vor allem auf diese Kriterien des Performativen konzentriert sich die Tagung. Sie fokussiert mit genau diesem Blick die früheren Synoden von Dresden und Würzburg. Sie bewertet die Ereignisqualität des gegenwärtigen Synodalen Weges und diskutiert Synodalität als mögliche Form zukünftiger Kirchenprozesse. Nur wenn Kirchenveränderung reflektiert ge- staltet wird, wird sie tragfähig. Dafür nimmt sich diese Tagung in den Dienst. Gegen jeden Stillstand und gegen jede Form des Realitätsverlustes – damit Kirche weitergehen kann.

Konstruierte Schöpfung? - Tagung der "Arbeitsgemeinschaft katholische Dogmatik und Fundamentaltheologie"
20.-22. September 2021 Tagungszentrum Hohenheim, Hybrid-Veranstaltung
In vielen Formen kommen auf unsere Gesellschaft Probleme und Herausforderungen zu, die von religiösen Traditionen im Zeichen von „Schöpfung“ bearbeitet werden. Angesichts des bedrängenden Klimawandels wird auch in säkularen Kontexten eine „Bewahrung der Schöpfung“ gefordert. Die Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus hat deshalb eine weltweite Resonanz ausgelöst. Die COVID-19-Pandemie ist in mancher Hinsicht auch eine Probe auf die Humanität unserer (Welt-) Gesellschaft. Gleichzeitig führt der Code „Schöpfung“ in anthropologischen wie rechtlichen und rechtspolitischen Fragen in kirchliche Konfliktfelder und bedarf philosophischer wie theologischer Klärungsarbeit. Die Tagung der Arbeitsgemeinschaft diskutiert mit interdisziplinären Vermerken unter dem Stichwort „Konstruierte Schöpfung“ Probleme und Perspektiven rezenter Schöpfungstheologien.

Voll(e) Macht? Kirchliche Synodalität im 21. Jahrhundert
Online Thementag am 22. Januar 2021
Vor 50 Jahren fand die Synode des Bistums Dresden-Meißen ihr Ende. Mit ihren Ideen, Debatten und Beschlüssen wurde sie nicht nur zum Impulsgeber der sich anschließenden Pastoralsynode der DDR, sondern steht auch für eine neue Verortung des Katholizismus in einer modernen Gesellschaft, die zugleich von Willkür und Atheismus geprägt war. Erregten die Beschlüsse der „Meißner Synode“ einerseits über die DDR -hinaus Aufsehen, weckten sie zugleich Widerstand und wurden in der Umsetzung spürbar ausgebremst. Ein Schicksal von Synoden in der katholischen Kirche? Der „Synodale Weg“ will das Gegenteil beweisen. Zugleich macht Papst Franziskus Mut, Synodalität für die katholische Kirche im 21. Jahrhundert neu zu denken.
Wenn das Bistum Dresden-Meißen im Jahr 2021 das 100. Jubiläum der Wiedererrichtung als Diözese feiert, lohnt sich der Blick auf bisherige Erfahrungen, um Synodalität weltweit und auch „auf mitteldeutsch“ (Joachim Wanke) neu zu buchstabieren. Der online-Thementag am 22. Januar 2021 lädt ein, sich darüber zu verständigen, wie künftig Synodalität kirchliche Entscheidungsprozesse gestalten kann, was wir von anderen Konfessionen lernen können, welches Kirchenbild dahinter steht und welche Möglichkeiten der aktuelle rechtliche Rahmen über nationale Grenzen hinweg bietet.
Die derzeitigen Prozesse zeigen: Um dem Empfinden und Verständnis der heutigen Menschen entgegen zu kommen, braucht es eine neue Balance von Macht und Vollmacht.

Gottesdienst und Macht Klerikalismus in der Liturgie - Findet digital statt
München, 28./29.Oktober 2020
Die Liturgiekommission der Deutschen Bischofskonferenz befasst sich seit Längerem mit der Frage nach Klerikalismus in der Liturgie. Gemeint sind damit Formen inadäquater Machtausübung und Herausstellung des priesterlichen Amtes, wie sie in der Praxis vorkommen, aber auch Asymmetrien und Hierarchien, die durch die liturgischen Ordnungen selbst vorgesehen sind und, in diesem Sinne legitimiert, verschiedene Formen von Klerikalismus befördern können.Das Thema soll in einer öffentlichen Fachtagung vertieft werden, die am 28./29. Oktober 2020 im Tagungs zentrum der Katholischen Akademie in Bayern (München) statt findet. Sie wird im Auftrag der Liturgiekommission der Deutschen Bischofs konferenz und im Kontext des Synodalen Weges veranstaltet. Die Tagung steht unter dem Titel „Gottesdienst und Macht – Klerikalismus in der Liturgie“. Das Angebot richtet sich an Multiplikatoren und haupt- und ehrenamtliche Praktiker aus Liturgie und Seelsorge, an Liturgiereferenten, Akteure aus der kirchlichen Bildungsarbeit, Ausbildungseinrichtungen, an die Mitglieder der Kommis sionen der Deutschen Bischofskonferenz, an Priester und andere hauptberufliche Seelsorgerinnen und Seelsorger, Theologinnen und Theologen, Studierende und die interessierte Öffentlichkeit.

Die Ehe – ein ganz spezieller Fall Theologische Perspektiven und aktuelle Fragen zur Sakramentalität der Ehe
Akademischer Festakt und Studientag, Erfurt, St. Ursula, 1.-2.7.2019
Die Ehe zwischen Christen ist nach katholischer Lesart ein Sakrament. Soweit, so gut. Doch zu beschreiben, worin das theologische Spezifikum dieser Verbindung zweier Menschen liegt, fällt schwer. Die Sakramentalität der Ehe einfach mit ihrer Unauflöslichkeit gleichzusetzen wäre unterkomplex. Sakramententheologische Standards der Theologiegeschichte passen nicht recht. Theologie, Liturgie und Recht der Ehe (-schließung) nahmen zudem durchaus verschiedene, ungleichzeitige und teilweise inkompatible Entwicklungen. Gegenwärtig wird die Sakramentalität der Ehe v.a. anlässlich von Konflikten thematisiert: Man debattiert über gescheiterte Ehen und mögliche kirchen- und arbeitsrechtliche Konsequenzen, über das Verhältnis von ziviler und sakramentaler Eheschließung, über die Herausforderung der Ehetheologie durch die Einführung der Zivilehe für homosexuelle Paare und vieles mehr.
Der Studientag dient der interdisziplinären Vergewisserung einer Theologie der Ehe, die liturgisch, dogmatisch, seelsorglich und kirchenrechtlich tragfähig ist. Er findet im Anschluss an den Festakt zum 40jährigen Jubiläum des Interdiözesanen Offizialats für das Gebiet der ostdeutschen Bundesländer statt. Eingeladen sind Studierende, Fachvertreter/innen und Praktiker/innen sowie Interessierte aus Theologie, Pastoral, Familien- und Eheberatung, Ordinariaten und Offizialaten.
Als Referent(inn)en wirken mit:
Julia Knop (EF), Gabriele Zieroff (R), Stephan Winter (OS/MS), Michael Seewald (MS), Hans-Joachim Sander (Salzburg), Tobias Gremler (EF), Myriam Wijlens (EF)

"Gott?" Oder: Was war eigentlich die Frage? Theologie nach dem Relevanzverlust ihres Gegenstands
Erfurt, St. Ursula, 24.-25.11.2017
Die Frage nach Gott lässt sich, ob explizit oder implizit gestellt, kaum mehr als anthropologische Konstante und damit allgemein akzeptable Basis zur Begründung theologischer Arbeit, ihrer Rationalität und Relevanz sowie ihres Standorts an staatlichen Universitäten ansetzen. Wie kann angesichts der epochalen Verschiebung der Gottesfrage und Gottesthematik zu einem Teil- und Minderheitennarrativ Theologie betrieben werden? Welche Konsequenzen und Aufgaben ergeben sich für die universitäre Theologie angesichts des Phänomens, dass ihre Kernfrage, also die Frage nach Gott und seiner Bedeutung für den Menschen, fundamental anders
oder gar nicht mehr gestellt wird?
Als ReferentInnen wirken mit:
Gert Pickel (L), Jan Loffeld (MS/EF), Rainer Bucher (Graz), Tobias Kläden (EF), Eberhard Tiefensee (EF), Hans-Joachim Höhn (K), Benjamin Dahlke (PB), Florian Baab (MS), Julia Knop (EF), Jürgen Werbick (MS).
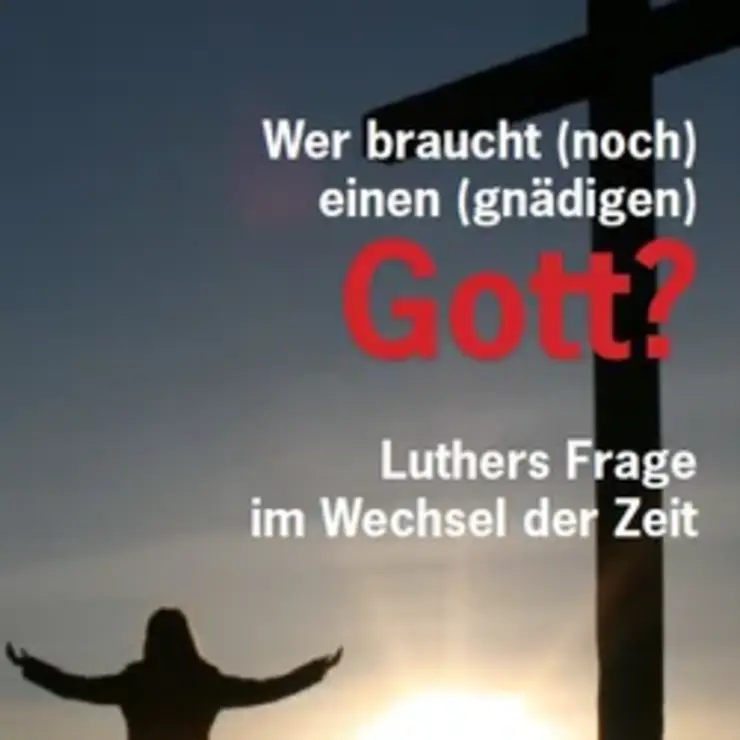
Wer braucht (noch) einen (gnädigen) Gott? Luthers Frage im Wechsel der Zeit
Köln (Domforum) und Bensberg (Thomas-Morus-Akademie), 17.-19.9.2017
Was Martin Luther im Kern bewegte, war die Frage nach Gott. Diese Frage ist bis heute aktuell – allerdings stellt jede Epoche ihre eigene Gottesfrage. Stand zur Zeit der Reformation der Mensch angesichts Gottes in Frage, so kehrte die Neuzeit und Moderne die Fragerichtung um: Wer ist Gott – angesichts des Menschen? Die Spät- bzw. Postmoderne entwickelt diese Lesart weiter, insofern die Frage nach Gott nunmehr selbst fraglich, immer weniger plausibel, kaum mehr (lebens-) relevant erscheint. Für die Kirchen im Jahr 2017 ist dies ein besonderer Impuls, insofern die Frage nach Gott und das Engagement für die Gottesfrage die Konfessionen verbindet, statt sie zu trennen, und eine ökumenische Basis des christlichen Zeugnisses für unsere Zeit sein kann.
Als ReferentInnen wirken mit:
Kurt Kard. Koch (Rom), Dorothea Sattler (MS), Friederike Nüssel (HD), Julia Knop (EF), Detlef Pollack (MS), Thomas Großbölting (MS), Hans-Joachim Höhn (K), Jan Loffeld (MS), Michael Schüßler (TÜ), Bernhard Spielberg (FR), Weihbischof Rolf Steinhäuser (K), Barbara Rudolph (K), Erzpriester Radu Constantin Miron (K), Gisela Muschiol (BN), Wolfgang Thönissen (PB) und Eberhard Tiefensee (EF).


