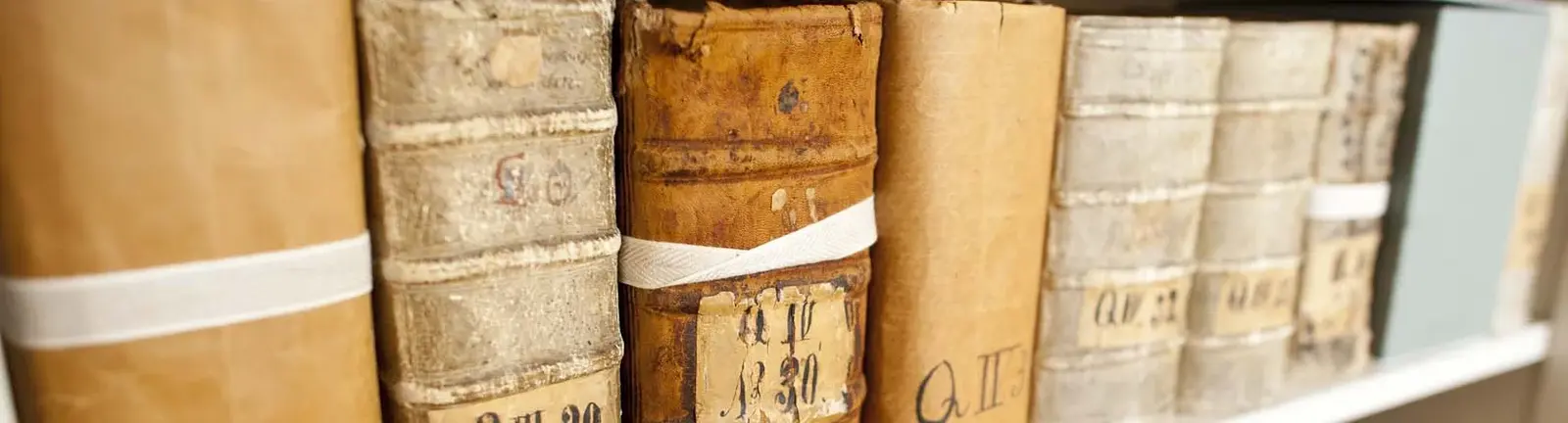
Das Projekt HisQu widmet sich der Entwicklung einer digitalen Forschungsdateninfrastruktur für historische Quellen. Im Zentrum steht die methodische Weiterentwicklung der digitalen Analyseprozesse, wie sie in den Geschichts- und Geisteswissenschaften zunehmend Anwendung finden. Ziel ist es, Werkzeuge und Standards zu etablieren, die den gesamten Forschungsprozess – von der Aufbereitung der Quellen bis zur Auswertung und Dokumentation – digital unterstützen und reproduzierbar machen. Das Projekt wird gemeinsam getragen von der Friedrich-Schiller-Universität, Arbeitsgruppe MEPHisto – Modelle, Erklärungen und Prozesse in den historischen Wissenschaften (Prof. Dr. Clemens Beckstein, Apl. Prof. Dr. Robert Gramsch-Stehfest), der Niedersächsischen Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Germania Sacra (Prof. Dr. Hedwig Röckelein), dem Deutschen Historischen Institut Rom, Repertorium Germanicum (Prof. Dr. Martin Baumeister) sowie dem Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt, FactGrid (Prof. Dr. Martin Mulsow). Das Projekt wird von der DFG gefördert.
Die Projektidee besteht in der digitalen Edition des persönlichen Briefwechsels der Erbgroßherzogin Maria Pavlovna (1786-1859) mit ihrer Mutter Kaiserin-Witwe Maria Fedorovna. Diese Korrespondenzen, die im Hauptstaatsarchiv Weimar aufbewahrt werden, eröffnen singuläre Einblicke in die Weimarer Verhältnisse zur Goethe-Zeit sowie in die internationale Bedeutung des Weimarer Hofs nach der Neuordnung Europas durch den Wiener Kongress.
Ziel des beantragten Forschungsprojekts ist es, die „Bibliotheca Anglicana“ innerhalb der gesamten Sammlung erstmals systematisch zu rekonstruieren, zu analysieren und in ihrer kontextualen Relevanz sichtbar zu machen. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Materialität der „englischen“ Bücher gelegt.
Am Ende der Förderperiode werden die Resultate nicht nur in einer Monographie (gedruckt) präsentiert, sondern es erfolgt auch eine publikumsorientierte Aufbereitung der „Bibliotheca Anglicana“ (digital, mittels Bibliotheksrekonstruktions-Tool LibReTo). Beide Ergebnisse bieten wertvolle Chancen für frühneuzeitliche Anschlussprojekte.
Das Projekt unter der Leitung von Gabriele Ball wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft für drei Jahre (01.11.2023-30.10.2026) gefördert.
Ziel des Vorhabens ist die Erschließung der Naturrechtslehre von Heinrich Cocceji (1644-1719) und seinem Sohn, Herausgeber und Fortsetzer Samuel (1679-1755).
Dieses Projekt untersucht die miteinander verflochtenen Praktiken der Herstellung und Veröffentlichung von botanischem Wissen, die die vernetzte Wissenskultur der frühneuzeitlichen Botanik geprägt haben. Der Fokus liegt dabei auf der textbasierten Praktiken, die die Forschung aufgrund einer anhaltenden Faszination für wissenschaftliche Objekte lange nur wenig beachtet hat. Spezifische Formen der Produktion und Zirkulation botanischer Texte haben ein Publikationssystem hervorgebracht, das von der botanischen Fachwelt genutzt wurde und diese zugleich konstituierte.
Am 2021 eingerichteten Sonderforschungsbereich/ Transregio SFB TRR 294 „Strukturwandel des Eigentums“ ist das FZG mit einem gemeinsam mit der Professur für Wissenschaftsgeschichte am Max Weber Kolleg durchgeführten Teilprojekt zum Thema "Besitz und Gewohnheit. Zur politischen Anthropologie von Eigentum in der westlichen Moderne" beteiligt.
Das Ekhof-Theater im Schloss Friedenstein verdankt seinen Namen Conrad Ekhof, unter dessen künstlerischer Leitung 1775 das Gothaer Hoftheater zur stehenden Bühne institutionalisiert wurde. Erbaut wurde es jedoch schon sehr viel früher. Die Nutzung vor 1775 ist äußerst vielfältig. Das Forschungsprojekt konzentriert sich auf das adlige Laientheater, das unter der Leitung von Franziska Juliane von Buchwald seit Mitte der 1730er Jahre vor allem französische Stücke zur Aufführung brachte, häufig zu feierlichen Anlässen und unter Mitwirkung von Mitgliedern der herzoglichen Familie. Gefragt wird nach dem intellektuellen Profil, das sich im Repertoire niederschlägt, und auch nach seinen Funktionen für die Hofkultur.
Der Theologe, Philosoph und Mediziner Johann Konrad Dippel (1673–1734) war einer der berüchtigtsten und zugleich populärsten Kirchenkritiker seiner Zeit. Mit seinen Streitschriften, in denen er mit bissigen Invektiven nicht sparte, stellte er die Grundfesten des lutherischen Protestantismus in Frage. Dank seiner Fähigkeit, komplexe theologische Sachverhalte allgemeinverständlich darzustellen, wurden seine Werke von den Aufklärern des 18. Jahrhunderts ebenso rezipiert wie von Handwerkern und Dienstmägden. Stilistisch betrachtet bewegen sich seine Schriften zwischen theologischer Polemik und literarischer Satire: Häufig belegt er seine Argumente nicht mit Bibelstellen, sondern mit Vernunftargumenten; komplexe theologische Probleme veranschaulicht er durch Analogien zu alltäglich-lebensweltlichen Vorgängen. Zuweilen kleidet er seine Texte in die Form von Bildern, Gedichten, visionären Traumerzählungen oder Parabeln und operierte dabei mit Stilmitteln wie Ironie, Parodie und literarischer Karikatur. Trotz ihrer augenfälligen literarischen Qualitäten hat die germanistische Forschung Dippels Schriften bisher fast vollständig vernachlässigt.
Ziel meiner Studie ist es, Dippels kontroverstheologische Schriften zu anderen Streitschriften seiner Zeit und seiner Konfession ins Verhältnis zu setzen und ihre literarischen Eigenheiten herauszuarbeiten. Sie richtet sich an folgenden Leitfragen aus: Welcher argumentativen und rhetorischen Strategien bedienten sich die Vertreter der unterschiedlichen Lager, inwiefern sind sie charakteristisch für deren jeweilige theologische Position? Welche Charakteristika lassen Dippels Streitpraktiken im Verhältnis dazu erkennen? Inwiefern wirken sich Dippels radikalpietistische Überzeugungen dabei stilbildend aus? Mit welchen Argumenten rechtfertigte er seine satirische Polemik? Kann seine rationalisierende Veranschaulichungsweise als ein frühaufklärerischer Säkularisierungsansatz bei der Vermittlung theologischer bzw. weltanschaulicher Fragen und moralischer Werte betrachtet werden? Und welche Rolle spielen ästhetische Erwägungen für Dippels Schreibart?
Am 1. Mai 1776 gründete der Kirchenrechtsprofessor Johann Adam Weishaupt mit fünf seiner Studenten an der Universität Ingolstadt eine Gesellschaft, die heute unter dem Namen Illuminatenorden bekannt ist. Auch wenn dieser spätaufklärerische Bund nur zwölf Jahre lang bestehen sollte, wirkten die hier entwickelten Ideen und Netzwerke noch Jahrzehnte weiter. Das Dissertationsprojekt beschäftigt sich im ersten Teil mit der Zusammensetzung und Verbreitung des Ordens sowie den Praktiken und Räumen der Ordensarbeit. Es wird aufgezeigt, an welchen Orten es Niederlassungen der Gesellschaft gab und wie diese miteinander interagierten. In direkter Wechselbeziehung zur Region stehen die Berufs- und Konfessionsstruktur innerhalb des Ordens. Diese Daten erlauben einen Einblick in das unmittelbare Um- und Wirkungsfeld der Ordensmitglieder sowie potenzielle Rekrutierungsräume: Arbeitsplätze, Ausbildungsstätten, Lesegesellschaften, Zeitschriftenredaktionen oder informelle Zirkel. Des Weiteren rücken auch Menschen in den Fokus, die zwar kein Mitglied waren oder werden konnten, jedoch dennoch indirekt Einfluss auf die Ordensarbeit nehmen konnten – allen voran die Ehefrauen der Illuminaten.Der zweite Schwerpunkt liegt auf der Nachfolgegeschichte des Ordens. Mit der Selbstauflösung der Gesellschaft endete für viele Mitglieder ein zentrales Forum für politischen Austausch und Geselligkeit. Es entwickelten sich in der Folge verschiedene Formen des Engagements, durch die vormalige Illuminaten aktiv blieben: sei es in der Freimaurerei oder anderen arkanen Gesellschaften, Lese- und Gelehrtengesellschaften, durch Bücher und Zeitschriftenaufsätze, in Stadträten und kommunalen Interessensvertretungen oder auch als Jakobiner – ebenso heterogen wie der Orden und die Spätaufklärung selbst waren, wurden seine Einflüsse in die verschiedensten Institutionen und Personennetzwerke weitergetragen.
Liest man über Herzog Ernst II. von Sachsen-Gotha und Altenburg, lässt sich erkennen: Das Narrativ des aufgeklärten, von freimaurerischen Ideen geprägten Fürsten, der sich intensiver seiner Leidenschaft für Wissenschaft und Künste zuwandte als der Politik, ist bis heute wirkmächtig geblieben. Innerhalb der Geschichtsforschung wurde dieser Fürst des ausgehenden 18. Jahrhunderts bislang vornehmlich in seinem regionalen Einflussbereich betrachtet; seine Aktivitäten wurden häufig isoliert voneinander untersucht. Als Herrscher eines kleinen mitteldeutschen Fürstentums präsentierte er sich – für die Familie der Ernestiner üblich – als Mäzen und suchte sein Ansehen durch die enge Verbindung zu Gelehrten und Künstlern zu steigern. Durch seine Teilhabe an zentralen politischen und gesellschaftlichen Bewegungen vereinte er verschiedenste Aspekte aufklärerischen Verhaltens. Als hochrangiges Mitglied zweier bedeutender Geheimbünde, der Freimaurer und der Illuminaten, galt Ernst als einflussreiche, herausragende Figur der Arkanwelt des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Mit ihrer politischen Zielsetzung unterschieden sich die Illuminaten deutlich von der Freimaurerei und standen damit dem fürstlichen Selbstverständnis grundlegend entgegen. Die Aktivität in diesem Geheimbund positionierte Ernst als regierenden Herzog zwischen widersprüchlichen Polen.
Diese Spannung steht im Zentrum der entstehenden Forschungsarbeit und verweist auf den zentralen Untersuchungszeitraum von ca. 1783 bis 1787. Auf Grundlage seiner Korrespondenz wird auf Mikroebene nach dem Agieren des Fürsten in diesen auseinandergehenden Lebensbereichen von Regierungs- und Geheimbundtätigkeit sowie und nach deren etwaigen wechselseitigen Beeinflussungen gefragt. Die Arbeit knüpft mit ihrem Fokus auf die Praxis des Briefeschreibens an die Selbstzeugnisforschung sowie mit ihrer biografischen Fragestellung an die Sozietätsforschung an. Das Projekt will mit dieser neuen Perspektive auf seine umfangreiche Korrespondenz zu neuen Erkenntnissen in der Thüringer Adels- und Sozietätsforschung beitragen.
Das Projekt widmet sich der Untersuchung der veränderlichen Zirkulation militärischen Wissens während der Frühen Neuzeit. Dies erfolgt Anhand des Beispiels des Herzogtums Sachsen-Gotha-Altenburg im 17. und 18. Jahrhundert, wobei der Fokus auf der Zeitspanne von 1670 bis 1770 liegt. Diese Auswahl bietet sich aus mehreren Gründen an. Erstens verfügte dieses Territorium in dieser Periode im Verhältnis zur eigenen Bevölkerung über sehr viele Soldaten, so dass es um 1700 sogar ein höherer Militarisierungsgrad als in Brandenburg-Preußen erreicht wurde. Zweitens nutzten die sachsen-gotha-altenburgischen Herzöge ihre Militärmacht nicht um selbst Krieg zu führen, sondern betrieben stattdessen seit dem späten 17. Jahrhundert unter Friedrich I. bis in die 1760er Jahre unter Friedrich III. auf internationalem Niveau Subsidienhandel, was die Überlassung von eigenen Truppen für finanzielle oder politische Unterstützung an andere Staaten meint. Drittens ermöglicht die Konzentration auf ein solch relativ überschaubares Territorium innerhalb einer nicht zu weit gefassten Zeitspanne eine bessere Analyse der verschiedenen Akteure und Praktiken bei der veränderlichen Zirkulation militärischen Wissens.
Hierbei wird zudem vermutet, dass aufgrund der Aufrüstung Sachsen-Gotha-Altenburgs sowie die mit ihr in Beziehung stehende Praxis des Subsidienhandels in diesem Zeitraum größere Dynamiken hinsichtlich der Verhältnisse zwischen territorialstaatlichem Militärwesen und frühneuzeitlichen Wissenskulturen greifbar sind. Die Darstellung dieser weitreichenden und vielfältigen Wechselwirkungen zwischen frühneuzeitlichen Militär und verschiedenen Wissensformen und Wissensarten bilden den zentralen Bestandteil dieser Arbeit. Dabei spielen die gegenseitige Beeinflussung von gelehrten, alltäglichen sowie administrativen Wissensbeständen für militärische Notwendigkeiten und Erwartungen ebenso eine Rolle wie die Wissenstransfers von der höfischen Zentrale über den (residenz-)städtischen Raum bis in die ländliche Peripherie. Darüber hinaus werden auf diese Weise ebenso bestimmte militärische Wissenskulturen des Hofes, der (Residenz-)Stadt und des Landes beschreibbar und können miteinander in Relation gesetzt werden. Somit verbindet dieses Projekt die ‚Neue Militärgeschichte‘ mit der ‚Neuen Wissensgeschichte‘ auf eine bisher einzigartige Weise.
rguably, Jean-Antoine Houdon (1741-1828) is one of the greatest sculptors of the eighteenth-century. But it is not Houdon’s artistic achievements which form the core of this project. Rather, the project carves out new environments, networks and global spaces of artistic, artisanal and scientific entanglement in the Enlightenment based on the practices and materialities of (re)production. Starting at the German courts and its francophile princes, in particular Houdon’s relationships at Gotha, the project interrogates the material objects to learn about the manifold milieus and networks of their making and worldwide circulation. It investigates, for example, the (re)production of Houdon’s sculptors in marble, terracotta or paper-mâché, which tells us much about the interconnectedness of art, craftmanship and manufacture, and explores the production of value and meaning in the diverse spaces of production (from workshops to manufacture), placement and exhibition (in courts, gardens, or public spaces). It discusses the relationship of artists, artisans, and scientists in joint training and separate milieus and institutions, and follows the international commission and circulation of works, their intermediaries, routes and means of transportation. Focusing on the practices, materialities and three-dimensionality of object-making, the project sheds a new light on enlightened global knowledge production at the intersection of art and commerce, individual and society, and aesthetic and scientific appropriation of the world as embodied in all three dimensions of space