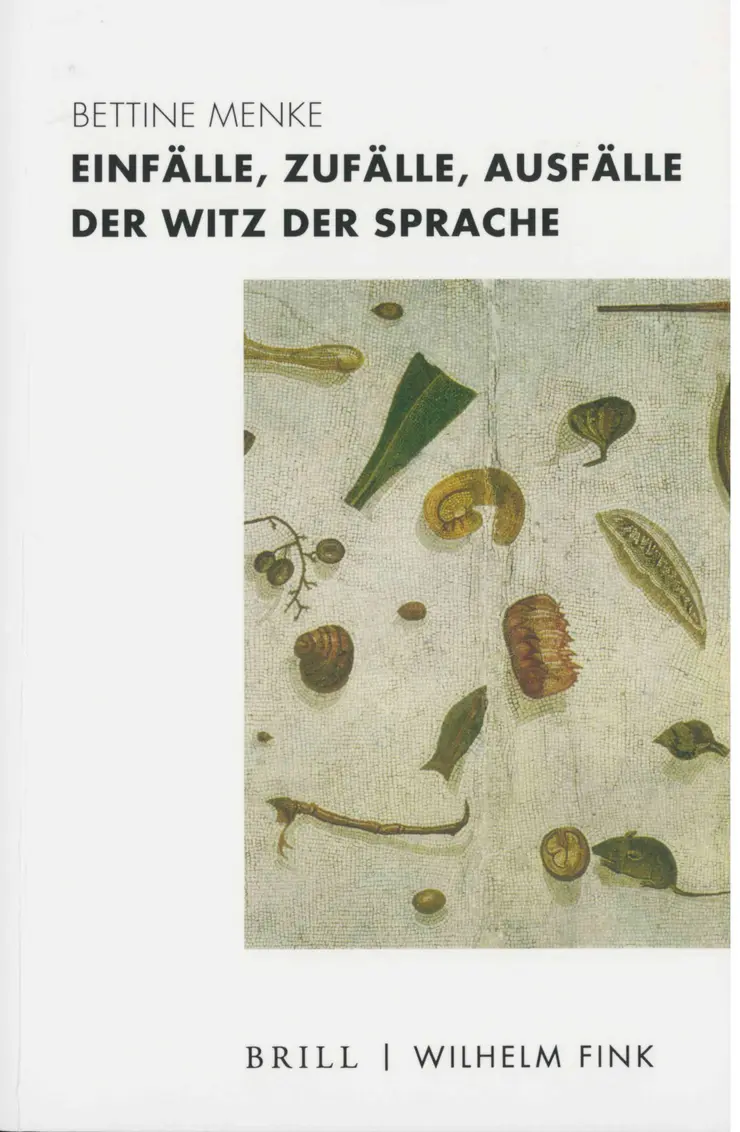Prof. Dr. Bettine Menke (seit dem 01.10.2023 im Ruhestand)
Sprechstunden können per Email (bettine.menke@uni-erfurt.de) verabredet werden.
Neuerscheinung 2022
Theatermaschinen - Maschinentheater - Von Mechaniken, Machinationen und Spektakeln
Theater sind Maschinen des Erscheinens. Und Theatermaschinen, die erscheinen lassen, verbergen sich selbst und bezeugen sich in ihren Effekten. Das teilen sie mit den Machinationen, wie Intrigen bis ins 19. Jahrhundert hießen. Sie widerstreiten dem Primat der dramatischen Handlung und ermöglichen in Verbindung mit Musik und anderen Illuminationen Theater als Spektakel. Die Beiträger*innen des Bandes fragen nach dem Zusammenhang von Maschine, Machination, Schauspiel und Schauraum. Mit der Figur der Maschine denken sie das Theater von seinen Rändern her und arbeiten heraus, wie ein maschineninduziertes Spektakel auch in Theaterformen (weiter-)lebt, denen das Spektakuläre suspekt geworden ist.
weitere Informationen hier

Publikation 2021
Einfälle, Zufälle, Ausfälle – Der Witz der Sprache
Das Buch bietet genaue Lektüren von Texten Jean Pauls, Kleists und Freuds (sowie Graciáns, Sternes, F. Schlegels und Joyce’s), und richtet sich damit auf jenen Zeitraum, in dem es mit der poetologischen und philosophischen Dignität des Witzes zu Ende ging oder schon vorbei ist. In diesem verschiebt sich, was mit »Witz« gemeint ist. Handelt es sich um 1800 noch um den Witz, »den der Witzige hat«, so seit dem 19. Jahrhundert um den, »den er macht« (so pointiert Freud).
Fokussiert wird der Witz als ein Ereignis der Rede, dessen unkalkulierbare Effekte sich als Einfälle wie Zu- oder Unfälle einstellen. Mit Jean Paul ist der Witz eine Kraft, die in ihrer Beschreibung nicht aufgeht. Sie manifestiert sich in plötzlichen Effekten vielfältiger und immer auch anders möglicher sprachlicher Relationen, die in den Wörtern lauern. Das Spiel mit Worten löst die Einheiten, geht auf die Buchstaben und selbst nicht-alphabetische schriftliche Marken zurück. Mit Freud kommt der Witz als sozialer Vorgang in den Blick, der Ereignischarakter der witzigen Äußerung dann als Verwicklung des Anderen ins Geschehen, dessen Medium das Lachen ist.
Was der Witz ausspielt, das betrifft auch theoretische Texte und Lektüren, das Verhältnis von Witz und Theorie.
Weitere Informationen hier.
Weitere Informationen
Curriculum vitae
Curriculum vitae
Lebenslauf:
Kurz: nach Promotion an der Universtät Konstanz (1987), Habilitation an der Europa-Universität Viadrina (1996),
und den Stationen: Universität Konstanz, J.W. Goethe Univ. Frankfurt, Philipps Univ. Marburg und EuropaUniversität Viadrina.
Seit 04/2000 Professorin der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft an der Universität Erfurt
Wissenschaftlicher Werdegang
Seit 04/2000 C 4-Professur für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Erfurt (seit 03/1999 Vertretung der eigenen Stelle), 09/2005 W 3-Professur an der Universität Erfurt (nach ausgeschlagenem Ruf an die Universität Wien)
10/1997 – 03/1998: WiSe 1997/1998 Vertretung C4-Professur Neuere Deutsche Literatur an der Philipps- Universität Marburg (beurlaubt in F/O)
06/1996 Habilitation an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder; Habilitationsschrift: „Die Rhetorik der Stimme und die Stummheit des Textes. Geräusche und Rauschen in und nach der Romantik“, venia legendi für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Germanistik.
10/1995 – 07/1996 Wahrnehmung eines DFG Habilitationsstipendiums (beurlaubt in F/O)
04/1995 – 02/1999 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder: Westeuropäische Literatur und DFG GRK „Repräsentation. Rhetorik. Wissen“, 02/1999 Ernennung zur Hochschuldozentin C2.
10/1993 – 03/1995 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Konstanz (Germanistik und DFG GRK „Theorie der Literatur“)
10/1992 – 09/1993 Zwei Gastprofessuren am Institut für Deutsche Literatur II der J.W. Goethe Universität in Frankfurt am Main
1988 – 09/1992 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Konstanz (Germanistik und DFG GRK „Theorie der Literatur“)
01/1988 Promotion (summa cum laude) an der Universität Konstanz, Dissertationsschrift: „Sprachfiguren. Figuren des Umwegs in der Theorie Benjamins“
10/1976 – 05/1982 Studium der Philosophie und der Germanistik an der Universität Konstanz
Gastaufenthalte, Senior Research Fellowships, Stipendien, Preise
· WiSe 2020/21 und SoSe 2021 Senior Research Fellow am Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald.
· 01. März – 31. Mai 2020 Senior Research Fellow am IFK Wien.
· WiSe 2015/16 und SoSe 2016: Senior Research Fellow am kulturwissenschaftlichen Kolleg der Universität Konstanz: exc.16 (Projekt: „Agon und Theater, Flucht und Szene“)
· WiSe 2010/11: Senior Research Fellow am Internationalen Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie (IKKM) der Bauhaus-Universität Weimar
· 10/2010: DAAD-Kurzzeitdozentur: Santiago de Chile, Universidad de Chile
· 09/2006 – 01/2007: Max Kade Visiting Professor an der UCSB, Santa Barbara
· 1995/96: DFG-Habilitationsstipendium (bewilligt 02/1995, angetreten 10/1995 – 07/1996)
· 1988: Promotions-Preis der Stadt Konstanz
· 1984 – 1986: Stipendium der Graduiertenförderung des Landes Baden-Württemberg
· 1976 – 1978: Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes Erfurt
Publikationen: Monographien und (Co)editierte Sammelbände
Monographien:
Sprachfiguren. Name - Allegorie - Bild nach Walter Benjamin, München 1991 (Buchfass. der Diss. Konstanz 1986).
Prosopopoiia. Stimme und Text, München (Fink) 2000 (Buchfass. der Habil.-Schrift 1996).
Korr. Neuaufl. von Sprachfiguren. Name – Allegorie – Bild nach Walter Benjamin, Weimar 2001.
Das Trauerspiel-Buch. Der Souverän – das Trauerspiel – Konstellationen – Ruinen, Bielefeld 2010.
Einfälle, Zufälle, Ausfälle. Der Witz der Sprache, München: Fink/Brill, 2021 [Aug. 2023 auch OA freigeschaltet].
(Mit-)Herausgaben
Erika Greber, Bettine Menke (Hg.): Manier, Manieren, Manierismen, Tübingen: G. Narr Vlg. 2003.
Bettine Menke, Barbara Vinken (Hg.): Stigmata. Poetiken der Körperinschrift, München: Fink, 2004.
Eva Horn, Bettine Menke, Christoph Menke (Hgg.): Literatur als Philosophie. Philosophie als Literatur, München: Fink, 2006.
Bettine Menke, Christoph Menke (Hg.): Tragödie. Trauerspiel. Spektakel, Berlin: Theater der Zeit, 2007.
Bettine Menke, Wolfgang Struck (Hg.): Wieland/Übersetzen. Sprachen, Gattungen, Räume. Berlin, New York: de Gruyter 2010.
Bettine Menke, Armin Schäfer, Daniel Eschkötter (Hg.): Das Melodram: ein Medienbastard, Berlin: Theater der Zeit, 2013.
Bettine Menke, Thomas Glaser (Hg.): Experimentalanordnungen der Bildung: Exteriorität – Theatralität – Literarizität, München: Fink, 2014.
Bettine Menke, Juliane Vogel (Hg.): Flucht und Szene. Perspektiven und Formen eines Theaters der Fliehenden, Berlin: Theater der Zeit, 2018 (peer reviewed).
Bettine Menke, Wolfgang Struck (Hg.) Theatermaschinen – Maschinentheater. Von Mechaniken, Machinationen und Spektakeln, transcript Verlag: Bielefeld, 2022 (peer reviewed)/ zugleich OA (https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/42/12/33/oa9783839453148.pdf).
(Mitherausgeberin, Sekt. II): Allegorie: (DFG-Symposion 2014), hgg. von Ulla Haselstein, unter Mitarbeit von Friedrich Teja Bach, Bettine Menke, Daniel Selden, De Gruyter, 2016.
I. Publikationen: Beiträge, Artikel in Zeitschriften, Handbüchern und Sammelbänden
Publikationen von vor 2000
Die Endlosigkeit des Einstiegs. Der semiologische Bruch und dessen dekonstruierende Lektüre (Neue Paradigmen in den Geisteswissenschaften?), in: Was sind und zu welchem Ende brauchen wir die Geisteswissenschaften?, Loccumer Protokolle 18/88, 1989.
Schriften, Texte, Tropen und Figuren. Die Aktualität der antiken Mnemotechnik und der rhetorischen Memoria; Frankfurter Rundschau 30. 1. 1990 (S. 22).
Dekonstruktion - Lektüre. Derrida literaturtheoretisch; in: Klaus-Michael Bogdal (Hrsg.), Neue Literaturtheorien. Eine Einführung, Westdeutscher Verlag, 1990, 235-264.
Das NachLeben im Zitat - Benjamins Gedächtnis der Texte, in: A. Haverkamp, R. Lachmann (Hrsg.): Gedächtniskunst. Text und Raum, Ffm. 1991, 74-110.
Aufgegebene Lektüre. Kafkas ‘Der Bau’, in: Die Aufgabe des Lesers (hg. v. Ludo Verbeek u. Bart Philipsen), Verlag Peters, Leuven, 1992, 147 - 175.
„Verstellt - der Ort der Frau. Ein Nachwort“, in Barbara Vinken (Hg.): Dekonstruktiver Feminismus. Kritik der Literaturwissenschaft, Ffm.: Suhrkamp, 1992, 436-476.
Horizont - Zur Semiologie der Entgrenzung; in: Émile, 4 (1991), 67-78.
Kafka-Lektüren. Über das Lesen und dessen Allegorie, in: Ästhetik und Kommunikation, Jg. 21 Hft. 79 (Oktober 1992): Ästhetik nach Adorno, 79-94.
„Die Rhetorik und das Schweigen. Kafkas ‚Das Schweigen der Sirenen‘“, in: Vorträge des Augsburger Germanistentags 1991. hg. v. J. Janota, Tübingen, 1993, Bd. 3 = Methodenkonkurrenz in der germanistischen Praxis, 134-162.
Die Verstellung und die schöne Stimme. Zum Konzept eines dekonstruktiven Feminismus, in: Interventionen 2: Raum und Verfahren, Museum für Gestaltung Zürich, hg.v. J. Huber u. A.M. Müller, Basel, Ffm. 1993, 65-87.
„De Mans Prosopopöie der Lektüre. Die Entleerung des Monuments“, in: K.H. Bohrer (Hg.), Aesthetik und Rhetorik. Lektüren zu Paul de Man, Ffm.: Suhrkamp, 1993, 34-78.
„Josefine, die Sängerin, oder die ‘Macht des Gesangs’“, in: Zur Verteidigung der Vernunft gegen ihre Liebhaber und Verächter, hg. v. Christoph Menke u. Martin Seel, Ffm: Suhrkamp, 1993, 385-414.
„Benjamin vor dem Gesetz. Die „Kritik der Gewalt“ in der Lektüre Derridas“, in: Gewalt und Gerechtigkeit nach Derrida und Benjamin, hg. v. Anselm Haverkamp, Ffm.: Suhrkamp, 1993, 217-276.
‘ Magie’ des Lesens: der Raum der Schrift. Über Lektüre und Konstellation in Benjamins „Lehre(n) vom Ähnlichen“, in: Namen, Texte, Stimmen. Walter Benjamins Sprachphilosophie (hg. v. Thomas Regehly, Iris Gniosdorsch), Hohenheimer Protokolle, 1994, 107-135.
Bild - Textualität. Benjamins schriftliche Bilder; in: Der Entzug der Bilder. Visuelle Realitäten (hg. v. Michael Wetzel u. Herta Wolf), München (Fink), 1994, 47-65.
Verstellt - der Ort der ‘Frau’ und die Stimme des Textes; in: Theorie - Geschlecht - Fiktion (20. 6. ‘92 in Basel), Stroemfeld/Nexus, Berlin & Basel, 1994, 185-204.
Interview Dekonstruktive Notwendigkeiten, in: [sic!]. Forum für Feministische Gangarten 4 (Okt. 1994), 21-3.
„Memnons Bild. Stimme aus dem Dunkel“, in: DVjs 68 (1994) Sonderheft für Geoffrey Hartman, 124-144.
„Ornament, Konstellation, Gestöber“, in: Zeichen zwischen Klartext und Arabeske, hg.v. S. Kotzinger, G. Rippl, Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1994, 307-326.
Art. ‘La dissémination’, für: Lexikon literaturtheoretischer Werke (hg. v. Rolf Günter Renner, Engelbert Habekost) Stuttgart, Kröner 1995, 105-107.
Rhetorik und Referentialität bei de Man und Benjamin (Vortrag Essen 1991 „Konvergenzen von Kritischer Theorie und Poststrukturalismus“), in: S. Weigel (Hg.), Flaschenpost und Postkarte, Böhlau 1995, 49-70.
„Dekonstruktion. Lesen, Schrift, Figur, Performanz“, für: Einführung in die Literaturwissenschaft. Grenzziehungen: Literatur, Wissenschaft, Theorie, hg. v. Pechlivanos, Rieger, Struck, Weitz, Stuttgart: Metzler, 1995, 116-137 (Tschechische Ausg. 2000).
„Sturm der Bilder und zauberische Zeichen. Kleists „Die Heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik. (Eine Legende)“, in: H. Birus, R. Warning (Hg.), Germanistik und Komparatistik (DFG-Symposion 1993), Stuttgart: Metzler, 1995, 209-245.
Dekonstruktion der Geschlechteropposition - das Denken der Geschlechterdifferenz, in: ‘Verwirrung der Geschlechter’. Dekonstruktion und Feminismus (hg. v. E. Haas), Profil-Verlag 1995, 5-41.
Erw. u. verb. Neuauflage von: Dekonstruktion - Lektüre. Derrida literaturtheoretisch, in: Klaus-Michael Bogdal (Hg.), Neue Literaturtheorien. Eine Einführung, Opladen (Westdeutscher Verlag) 1997, 241-272.
Körper-Bild und -Zerfällung, Staub. Über H.v. Kleists Penthesilea, für: Körper Gedächtnis Schrift (hg. v. B. Wiens, C. Öhlschläger) Berlin, München 1997, 122-156.
„Prosopopoiia. Die Stimme des Textes - die Figur des ‘sprechenden Gesichts’“, in: G. Neumann (Hg.), Poststrukturalismus, Herausforderung an die Literaturwissenschaft (DFG-Symposion 1995), Stuttgart: Metzler 1997, 226-251.
„Rahmen und Desintegrationen - Die Ordnung der Sichtbarkeit, der Bilder und der Geschlechter. (Zu Stifters Der Condor)“, in: Weimarer Beiträge 44 (3/1998), 325-363.
Allegorie, Personifikation, Prosopopöie. Von Steinen und Gespenstern, in: Allegorie - zwischen Bedeutung und Materialität, hg. v. Eva Horn, Manfred Weinberg, Opladen (Westdeutscher Verlag) 1998, 59-73.
Fontanes Melusinen, in: „Die Bilder der neuen Frau in der Moderne“, Tagungsband der Internationalen Tagung Gender-Forschung, 24. - 28. März ‘98, Wroclaw (Polen), hg.v. K. Gabryjelska, M. Czarnecka, Ch. Ebert Wroclaw 1998, 25-50 (polnische Fass. erschien 1999).
Die „Kritik der Gewalt“ in der Lektüre Derridas, in: global benjamin, Internationaler Walter-Benjamin-Kongreß 1992, hg.v. Klaus Garber, Ludger Rehm, München (Fink) 1999, Bd. 3, 1671-1690.
Töne - Hören, in: Joseph Vogl (Hg.), Poetologie des Wissens, München (Fink) 1999, 69-96.
Publikationen bis 2005
Art. Allegorie, „Aesthetica“ (mit A. Haverkamp), in: „Historisches Wörterbuch Ästhetischer Grundbegriffe“ (hg. v. Karlheinz Barck, Martin Fontius, Dieter Schlenstedt, Burkhart Steinwachs, Friedrich Wolfzettel), Stuttgart (Metzler) 2000, Bd. I, 49-104.
„Penthesilea - Das Bild des Körpers und seine Zerfällung“, in: Erotik und Sexualität im Werk Heinrich von Kleists (Heilbronner Kleist-Kolloquien II). Heilbronn 2000, 117-136.
Memnons Bildsäule. Ein Emblem der Romantischen Poesie, in: „Ägyptenimagination von der Antike bis heute“, Schriften des Kunsthistorischen Museums 3, hg. v. W. Seipel, Mailand 2000, 311-321.
„Akustische Experimente der Romantik“, in: neue vorträge zur medienkultur, hg. v. Claus Pias, Weimar: VDG 2000, 165-184.
„Die Polargebiete der Bibliothek. Über eine metapoetische Metapher“, DVjs 4/ 2000, 545-599.
„Zur Frage der Gespenster“, Beitrag zu Rembert Hüser: „We are Familiy - (remix 98)“, in: Jörg Schönert (Hg.): Literaturwissenschaft und Wissenschaftsforschung, Stugart, Weimar (Metzler) 2001, 573-599 [589/90].
„Wie man in den Wald hineinruft ...“ Die Echos des Übersetzens, in: Übersetzen: Walter Benjamin, hg.v. C. Hart-Nibbrig, Ffm.: Suhrkamp, 2001, 367-393.
„Adressiert in der Abwesenheit. Zur romantischen Poetik und Akustik der Töne“, in: Die Adresse des Mediums (Mediologie 2), hg. v. Eckhard Schumacher, Georg Stanitzek (SFB „Medien und kulturelle Kommunikation“), Köln: DuMont 2001, 89-104.
NachWort zu Judith Butler: „Antigones Verlangen. Verwandtschaft zwischen Leben und Tod“, hg. v. Gary Smith (Veröffentl. d. Einstein-Forum Potsdam), Ffm.: Suhrkamp (es 2187) 2001, 139-156.
„Die Ordnung der Geschlechter und ihre Zerfällung (Penthesilea)“, in: Grenzüberschreitungen: „Feminismus“ und „Cultural Studies“, hg. v. Hanjo Berressem, Dagmar Buchwald, Heide Volkening, Bielefeld: Aisthesis 2001, 181-207.
„Das Polargebiet als Bibliotheksphänomen und die Polargebiete der Bibliothek: Nachfahren Petrarcas und Dantes im Eis und in den Texten“, in: Ultima Thule. Bilder des Nordens von der Antike bis zur Gegenwart, hg. v. Annelore Engel-Braunschmidt, Gerhard Fouquet, Wiebke von Hinden, Inken Schmidt, P. Lang Verlag 2001, 145-172.
Art. Eucharistie, in: „Lexikon Gedächtnis und Erinnerung“ (hg. von N. Pethes, J. Ruchatz), Rowohlt-Verlag 2001.
Art. Zitat, in: „Lexikon Gedächtnis und Erinnerung“ (hg. von N. Pethes, J. Ruchatz), Rowohlt-Verlag 2001.
„Zitierfähigkeit: Zitieren als Exzitation“, in: Zitier-Fähigkeit. Findungen und Erfindungen des Anderen, hg. v. Andrea Gutenberg, Ralph J. Poole, Berlin: E. Schmidt Vlg. 2001, 153-171.
„Ornament, Constellation, Flurries“ (überarb. Übers. von „Ornament, Konstellation, Gestöber“), in: Walter Benjamin’s Ghosts: Interventions in Contemporary Literary and Cultural Theory, hg. v. Gerhard Richter, Stanford University Press 2002, 260-277.
„Die Wiederholung, die das Echo ist“, in: Wunsch-Maschine-Wiederholung, hg. v. J. Wiesel u.a., Freiburg: Rombach 2002, 171-196.
„Rhetorik der Stimme“, in: Medien- und Kulturgeschichte der Stimme, hg. v. Friedrich Kittler, Thomas Macho, Sigrid Weigel, Berlin: Akademie Verlag 2002, 115-132.
„Leiche als Emblem“, in: KörperTopoi. Sagbarkeit – Sichtbarkeit – Wissen. hg. v. Dietmar Schmidt, Weimar: VDG 2002, 225-248.
„Jean Pauls Witz. Kraft und Formel“. DVjs (Sonderheft zu Ehren von Wolfgang Preisendanz: Formgeschichte als Provokation - Wolfgang Preisendanz’ Anteil), 2/ 2002, 201-213.
„Zitat, Zitierbarkeit, Zitierfähigkeit“, in: Anführen – Vorführen – Aufführen. Texte zum Zitieren, hg. v. V. Pantenburg, N. Plath, Bielefeld: Aisthesis 2002, 273 - 280.
‘Whatever one calls into the forest ...‘ . translations - echoes, in: Benjamin and Romanticism, hg. v. Andrew Benjamin, Beatrice Hanssen, London, New York: Athcontiuum 2002, 83-97 u. 218-224 (neue, überarbeitete und erweiterte engl. Fass. von „’Wie man in den Wald hineinruft ...’ Die Echos des Übersetzens“).
„Die Zonen der Ausnahme. Giorgio Agambens Umschrift Politischer Theologie, in: Politische Theologie. Form und Funktionen im 20. Jahrhundert, hg. v. Jürgen Brokoff, Jürgen Fohrmann, Paderborn: Schöningh 2003, 131-152.
„Pol-Apokalypsen. Die Enden der Welt und der Spuren“, in: Apokalypse. Der Anfang im Ende, hg. V. Maria Moog-Grünewald, Verena Olejniczak, Tübingen: Universitätsverlag Winter 2003, 311-337.
„Rhetorik der Echo. Echo-Trope, Figur des Nachlebens“, in: Weibliche Rhetorik - Rhetorik der Weiblichkeit, hg. v. Dörte Bischof, Martina Wagner-Egelhaff, Freiburg: Rombach 2003, 135-159.
„Fontanes Melusinen. Bild – Arabeske – Allegorie“, in: Das verortete Geschlecht, hg. v. Petra Leutner, Ulrike Eriksen, Tübingen: Attempto Verlag 2003, 101-125.
- mit Erika Greber: „Einleitung“ zu: Manier, Manieren, Manierismen, hg. v. E. Greber, B. Menke, Tübingen: G. Narr Vlg. 2003, 7-10.
„Ein doppelzüngiger Schelm. Freuds Witz“, in: Manier, Manieren, Manierismen, hg. v. E. Greber, B. Menke, Tübingen: G. Narr Vlg. 2003, 157-180.
- mit Dietmar Schmidt: „Ritual im Aufschub. Gottesgericht, Ehrenhandel und literarische Performanz bei Kleist, Conrad und Puschkin“, in: Das Gedächtnis des Gedächtnisses. Zur Präsenz von Ritualen in beschreibenden und reflektierenden Texten, hg. v. B. Kranemann, J. Rüpke, Marburg: diagonal-Verlag 2003, 103-155.
„Witz“, in: Der komische Körper, hg. v. Eva Erdmann, Bielefeld: Transcript, 2003, 238-247.
„Mneme/Mnemonik“, für: Archiv für Mediengeschichte, N° 3: Medien in der Antike, Universitätsverlag Weimar 2003, 121-136.
„The Figure of Melusine in Fontane’s Texts. Images, Digressions, and Lacunae“, überarb. engl. Fass. für: Germanic Review 79 n°1, Winter 2004, 41-67.
„Die Performanz der Zitation“, in: Rhetorik. Figuration und Performanz, Germanistische Symposien der DFG, hg. von Jürgen Fohrmann, Stuttgart: Metzler 2004.
„’Mund’ und ‚Wunde’. Zur grundlosen Begründung der Texte“, in: B. Menke, B. Vinken (Hg.): Stigmata. Poetiken der Körperinschrift, München: Fink 2004, 269-294.
Einleitung „Zur Archäologie eines trügerischen Phänomens in Mittelalter und Moderne“: „Nachträglichkeiten und Beglaubigungen“, zu B. Menke/ B. Vinken (Hgg.): Stigmata. Poetiken der Körperinschrift, München: Fink 2004, 25-43.
„Anfangen – zur ‚Herkunft der Rede’“, in: Herkünfte. Historisch, ästhetisch, kulturell, hg. v. Barbara Thums, Volker Mergenthaler, Nicola Kaminski, Doerte Bischof, Heidelberg: Winter 2004, 13-37.
„Aufgezeichnete Bewegung: Schall-Figur, Bewegungs-Bild“, in: Kinetographien, hg. v. Inke Arns, Mirjam Goller, Susanne Strätling, Georg Witte, Bielefeld 2004, 159-177.
„Die Worte und die Wirklichkeit, anläßlich der Frage nach ‚Literatur und Selbsttötung’, am Beispiel Heinrich von Kleists“, in: Kleist-Jahrbuch 2004, 21-41.
„Lesarten des Labyrinths/Schemata des Lesens“, in: „... in jedem Augenblick auf das Äußerste gefaßt“. Aus dem Labor philologischer Neugierde, hg. von Caroline Welsh, Christoph Hoffmann, Schriftenreihe des Max-Plank-Instituts für Wissenschaftsgeschichte: Preprint 278, 2005, 89-100.
„Rhythmus und Gegenwart. Fragmente der Poetik um 1800“, in: Geteilte Zeit. Zur Kritik des Rhythmus in den Künsten. hg. v. Patrick Primavesi, Simone Mahrenholz (Zeiterfahrung und ästhetische Wahrnehmung Bd. 1, hg. v. Hans-Thies Lehmann, Burkhardt Lindner), Edition Argus 2005, 193-204.
mit Dietmar Schmidt, „Am Nullpunkt des Rituals. Darstellung und Aufschub des Zweikampfs bei Kleist, Conrad und Puschkin“, in: Arcadia Bd. 40 (2005), 194-236.
„’Literatur und Selbsttötung’, am Beispiel Heinrich von Kleists. Oder: Die Worte und die Wirklichkeit“, in: Andreas Bähr, Hans Medick (Hgg.): Sterben von eigener Hand. Selbsttötung als kulturelle Praxis, Weimar: Böhlau 2005.
II. Publikationen: Beiträge, Artikel in Zeitschriften, Handbüchern und Sammelbänden
Publikationen bis 2010
„Reflexion des Trauer-Spiels. Pedro Calderón de la Barcas El mayor mónstruo, los celos nach Walter Benjamin“, in: E. Horn, B. Menke, C. Menke (Hgg.): Literatur als Philosophie. Philosophie als Literatur, München: Fink 2006, 253-280.
mit Eva Horn, Christoph Menke: „Einleitung“, zu: E. Horn, B. Menke, C. Menke (Hgg.): Literatur als Philosophie. Philosophie als Literatur, München: Fink 2006, 7-14.
„Der Witz, den die Lettern und den die Löcher machen, ....“, in: Sichtbarkeit der Schrift, hg. von S. Strätling, G. Witte, München (Fink) 2006, 203-215.
„beim babylonischen Turmbau ...“, in: Fremdheit bei Kafka, hg. v. Hansjörg Bay, Christof Hamann, Freiburg: Rombach 2006, 89-114.
„Lesarten des Labyrinths/ Schemata des Lesens“, in: Umwege des Lesens. Aus dem Labor philologischer Neugierde, hg. von Christoph Hoffmann, Caroline Welsh, (Korr. und Erw. Ausgabe), Berlin: Parerga 2006, 185-206.
„Ratzinger-in-Displacement“, in: Ratzinger Funktion, Meinecke u.a., Ffm.: Suhrkamp es 2466, 2006, 56-92.
Art. Ursprung des deutschen Trauerspiels, in Benjamin-Handbuch, hg. v. Burkhardt Lindner, Stuttgart: Metzler 2006, 210-229 [Korr. Taschenbuch-Ausgabe 2011].
„Das Schweigen der Sirenen: Die Rhetorik und das Schweigen“ [Neuabdruck, überarbeitet u. gekürzt], in: Franz Kafka. Neue Wege der Forschung, hg. von Claudia Liebrand, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2006, 116-130.
...’jenseits’ von Forschritt und Ende? (Kommentar zu E. Geulen „Und weiter.“), in: „Kunst – Fortschritt – Geschichte“, hg. von Christoph Menke, Juliane Rebentisch, Kulturverlag Kadmos Berlin, Kaleidogramme Bd. 5, 2006, 148-156.
„Walter Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiels (1928)“, in Sprache und Literatur Jg. 37, Heft 98 (2006/ 2. Halbj.), 25-76.
„Wozu Schiller den Chor gebraucht ... .“ in: Tragödie. Trauerspiel. Spektakel, hgg. von B. Menke, C. Menke, Berlin (Theater der Zeit, Reihe Recherche) 2007, 72-100.
- mit Christoph Menke: „Tragödie – Trauerspiel – Spektakel. Drei Weisen des Theatralen“, Einleitung zu Tragödie. Trauerspiel. Spektakel, Berlin 2007, 6-15.
„Exzeß der Performanz – Interventionen der/ in die Schrift. Kleists Witz“, in: Die Szene der Gewalt. Bilder, Codes und Materialitäten, hgg. von D. Tyradellis, B. Wolf, Frankfurt a. M., Berlin, Bern, New York, Oxford, Wien 2007, 141-156.
Holes and Excesses: On Wit and the Joke in Kleist’s “Anecdote from the Last War”, MLN – Vol. 122, Nr. 3 April 2007 (German Issue, ed. by Rochelle Tobias), 647-664.
„Sumpf und Mauer (Blumenberg, Wittgenstein, Husserl)“, in: Stehende Gewässer, hgg. von Alexander Klose, Helga Lutz et al. (Publikation des Grad. Koll. Mediale Historiographie), Berlin: diaphanes 2007, 141-148.
„Die Gewalt einer Mitteilung, die ver-rückt“. Über Medien von Religion in Heinrich von Kleists ‚Die Heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik. Eine Legende’ (1811), in: Religion in den Medien - Medien der Religion, hg. von J. Malik, J. Rüpke, T. Wobbe, Münster: Aschendorff, 2007, 131-151 u. 228-237.
„Zur Evidenz - der Stigmata“. In: Rhetorik und Religion, hg. v. H. Meyer, D. Uffelmann, Stuttgart 2007, 134-151.
„Ein-Fälle aus Exzerpten. Die inventio des Jean Paul“, in: Rhetorik als kulturelle Praxis, hg. von R. Lachmann, R. Nicolosi, S. Strätling, München (Fink), 2008, 291-307.
„‚Gelehrtenleben’ und ‚wissenschaftliche Praxis’ des Jean Paul“, in: Gelehrtenleben. Wissenschaftspraxis in der Neuzeit, hg. v. Alf Lüdtke, Rainer Prass, Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2008, 113-130.
„Die Intertextualität, die Aussetzung der Darstellung und die Formeln der Passion“, in: Rüdiger Campe (Hg.): Penthesileas Versprechen. Exemplarische Studien über die literarische Referenz, Freiburg: Rombach 2008, 211-252.
„Rhetorik der Echo. Echo-Trope, Figur des Nachlebens“, in: Kulturwissenschaftliche Germanistik in Asien (Internationale Asiatische Germanistentagung 2006 in Seoul), Hg. von der Koreanischen Gesellschaft für Germanistik, Redaktion: Gyung-Jae Jun u.a., Seoul (Korea) 2008, Bd. 1, 73-93.
„– Gedankenstriche –“, in: Am Rande bemerkt. Anmerkungspraktiken in literarischen Texten, hg. von Bernhard Metz, Sabine Zubarik, kadmos-Verlag: Berlin, 2008, 161-190.
„Stimme-Geben“, in Gabe, Tausch, Verwandlung. Übertragungsökonomien im Werk Clemens Brentanos, hgg. von Ulrike Landfester, Ralf Simon, Würzburg: Könighausen & Neumann 2009, 69-86.
„Zur Kritik der Gewalt: Techniken der Übereinkunft, Diplomatie, Lüge“, in: Techniken der Übereinkunft. Zur Medialität des Politischen (hgg. von Hendrik Blumentrath, u.a.) Berlin: Kulturverlag Kadmos (Kaleidogramme Bd. 38) 2009, 37-56.
„Sumpf und Mauer, zur Philosophie der Unbestimmtheit“, in: Metaphorologie. Zur Praxis von Theorie, hgg. von Anselm Haverkamp, Dirk Mende, Ffm.: Suhrkamp, 2009, 316-338.
„Nach–Feiern: Wozu Schiller den Chor gebraucht ...“, in: Schiller. Gedenken – Vergessen – Lesen, hg. von Rudolf Helmstetter, Holt Meyer, Daniel Müller Nielaba, München: Fink 2010, 37-57.
Bildlos, ungeformt, unbestimmt: das Medium der Bilder. Zu den prekären Bildern Walter Benjamins, in: Prekäre Bilder, hgg. von Thorsten Bothe, Robert Suter (eikones Basel & Graduiertenkolleg Mediale Historiographien), München: Fink 2010, 19-39.
„Alphabetisierung. Kombinatorik und Kontingenz, Jean Pauls Leben Fibels, des Verfassers der Bienrodischen Fibel“, in: ZMK (Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung) 2/ 2010 (F. Meiner Verlag), 43-59.
„Stekenpferde – Zum deutschen Shakespeare“, in: Wieland/Übersetzen. Sprachen, Gattungen, Räume, hgg. von B. Menke, Wolfgang Struck, Berlin/New York: de Gruyter 2010, 13-42.
Zus. mit Wolfgang Struck: „Wieland/Übersetzen. Einleitung“, in: Wieland/Übersetzen. Sprachen, Gattungen, Räume. hgg. von B. Menke, Wolfgang Struck, de Gruyter 2010, 1-9.
„Die anagogische Lesart: Verhüllung, Nachahmung, Hybridität und/der Übersetzungen“, in: Die Hyäne. Lesarten eines politischen Tiers, hgg. von Markus Krajewski, Harun Maye, Zürich: diaphanes, 2010, 87-110.
Publikationen bis 2015
„Schirm und Differenz“, in Rhetorik-Jahrbuch Bd. 29, 2011, hg. von Dörte Bischof, Martina Wagner-Egelhaff, 69-78.
„Tatorte: eigensinnig“, für: Topos Tatort, hgg. von Anna Häusler, Jan Henschen, Bielefeld: Transcript, 2011, 15-30.
„Stimmen/ Gemurmel: Aupfropfungen, Exzitationen, Szenen in Marthalers Murx den Europäer! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn ab!“, in: Pfropfen. Impfen. Transplantieren, hg. von Uwe Wirth, Berlin: Kadmos 2011, 173-195.
„Grenzen der Darstellung, Entsetzen“, in: Ortrud Gutjahr (Hg.): „Das Kätchen von Heilbronn“ und „Penthesilea“ von Heinrich von Kleist, Würzburg 2011, 147-165.
„Lesen Lesen. Zum Beispiel: Inwiefern Freuds Witze (nicht) Beispiele für seine Witz-Theorie sind“, für: Theorietheorie. Wider die Theoriemüdigkeit in den Geisteswissenschaften, hgg. von Mario Grizlj, Oliver Jahraus, München: Fink 2011, 331-352.
Taschenbuch-Ausgabe von Art. Ursprung des deutschen Trauerspiels, in: Benjamin-Handbuch, hg. v. Burkhardt Lindner, Stuttgart: Metzler 2011, 210-229.
„Vorkommnisse des Zitierens, Stimmen – Gemurmel. Zu Marthalers ›Murx den Europäer! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn! Murx ihn ab‹“, in: Kreativität des Findens. Figurationen des Zitats, hg. von M. Roussel, München (Fink) 2011, 69-89.
„Die Allegorie der Auferstehung“, in: Medien der Auferstehung, hg. von Helga Finter, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien (Peter Lang Verl.: Theaomai – Studien zu den performativen Künsten, Bd. 4), 2012, 93-119.
„Auslassungszeichen, Operatoren der Spatialisierung – was ‚Gedankenstriche’ tun“, in: Von Lettern und Lücken. Zur Ordnung der Schrift im Bleisatz, hgg. von Mareike Giertler, Rea Köppl, München: Fink, 2012, 73-95.
„Sirene“- Eintrag in: Zoologicon, Fs. für Thomas Macho, hgg. von C. Kassung, J. Mersmann, München: Fink, 2012, 386-391.
„Grenzüberschreitungen in der Schrift: Exterritorialität der Pole“, in: Reiseliteratur - Nachschriften. hgg. von H.J. Bay, W. Struck, Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2012, 53-78.
„Kritzel – (Lese-)Gänge“, in: Über Kritzeln, hgg. von Benjamin Meyer Krahmer, u.a., Zürich: diaphanes, 2012, 189-213.
“Hollow Earth: The Exterritoriality of the Poles”, in: Hanjo Berressem (Hg.): Between Science and Fiction: The Hollow Earth as Concept and Conceit, Berlin: LIT-Verlag 2012, 233-263.
„Ovids Echo und das Nachleben der Dichtung“, in: Carmen Perpetuum: Ovids Metamorphosen in der Weltliteratur, hgg. von Henriette Harich-Schwarzbauer, Alexander Honold, Basel: Schwabe 2013, 21-42.
„Das Melodram. Ein Medienbastard (Einleitung)“, zus. mit Armin Schäfer, Daniel Eschkötter, in: Das Melodram. Ein Medienbastard, hgg. von B. Menke, A. Schäfer, D. Eschkötter, Berlin (theater der zeit: recherche) 2013, 7-17.
„Glückswechsel, Kontingenz und Tableaux in Balzacs La Peau de chagrin“, in: Das Melodram. Ein Medienbastard, hgg. von B. Menke, A. Schäfer, D. Eschkötter, Berlin (theater der zeit: recherche) 2013 [ISBN 978-3-943881-06-6], 204-229.
„pun“, in: Eva Horn, Michèle Lowrie (Hg.): Denkfiguren, für Anselm Haverkamp/ Figures of Thought, for Anselm Haverkamp August Verlag 2013, 167-172.
„Respondance: Das der Rede eingeschriebene Andere, die Echoräume der Rede (mit Ovids Echo)“, on-line Publikation der Tagung Die Praxis der/des Echo (Institut für Theaterwissenschaft Leipzig Febr. 2013), publikationen.ub.uni-frankfurt.de/frontdoor/index/index/year/2018/docId/47258.
„Kafkas Labyrinthe“, in: Malte Kleinwort, Joseph Vogl (Hg.): »Schloss«-Topographien. Lektüren zu Kafkas Romanfragment, Bielefeld: transcript, 2013, 33-65.
„Dankbarkeit“, kleine Simmel-Lektüre, in: Dank sagen. Politik, Semantik und Poetik der Verbindlichkeit, hg. von Natalie Binczek, Remigius Bunia, Till Dembeck, Alexander Zons, München (Fink) 2013, 27-37.
„Ein-Fälle. Übertragungen und Zufälle des Witzes (Jean Paul)“, in: Rhetorik der Übertragung, hg. von Daniel Müller-Nielaba, Yves Schumacher, Christoph Steier, Könighausen & Neumann 2013, 33-52.
„Aura, the Object, and the Medium“, in: The Challenge of the Object / Die Herausforderung des Objekts, Congress Proceedings, 33rd Congress of the International Committee of the History of Art, Congress Proceedings, 4. Bde., hg. von G. Ulrich Großmann/Petra Krutisch, (32. Wissenschaftlicher Beiband zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums) Nürnberg 2013, Part 3., 865-868.
mit Thomas Glaser: „Experimentalanordnungen der Bildung: Exteriorität – Theatralität – Literarizität. Ein Aufriss“, in dies. (Hgg.): Experimentalanordnungen der Bildung: Exteriorität - Theatralität – Literarizität, München: Fink, 2014, 7-21.
„Die ‚Äußerlichkeit’ der Dramaturgie, Komik und Zufälle der Intrige (Mit Calderón und Shakespeare zu „Grenzen“ und zum Nachleben des Trauerspiels)“, in: Benjamins Trauerspiel, hgg. von Claude Haas, Daniel Weidner, Berlin: Kulturverlag Kadmos 2014, 29-57.
„Die Zufälle der Sprache. Der Witz der Worte und die Unentscheidbarkeit von Spiel oder Ernst (anhand von Gracián und Jean Paul)“, in: Spiel und Ernst. Formen – Poetiken – Zuschreibungen, Zum Gedenken an Erika Greber, hg. von D. Kretschmar, C. Lubkoll, D. Niefanger, S. Schukowski, Würzburg: Ergon Verl. (Reihe: Literatura Bd. 31), 2014, 37-51.
„On/Off“ (Einl. zu 2. Sektion), in: Auftreten. Wege auf die Bühne, hgg. von Juliane Vogel, Christopher Wild, Berlin: theater der zeit, 2014, 180-188.
„Suspendierung des Auftritts“, in: Auftreten. Wege auf die Bühne, hgg. von Juliane Vogel, Christopher Wild, Berlin: theater der zeit, 2014, 247-273.
„Text-Oberfläche: Figur und Grund, der Text und seine Ränder, Glossen, Kommentare“, in: Das Wissen der Oberfläche. Episteme des Horizontalen und Strategien der Benachbarung. hgg. von Christina Lechtermann, Stefan Rieger, Berlin: diaphanes, 2015 (ISBN 978-3-03734-747-8), 125-148.
„Suspensionen des Auftritts. Lulu – Pollesch“, in: Auftritte. Strategien des In-Erscheinung-Tretens in den Künsten und Medien, hgg. von Annemarie Matzke, Ulf Otto, Jens Roselt, Bielefeld: transcript, 2015, 213-244 [Print-ISBN 978-3-8376-2392-5; PDF-ISBN 978-3-8394-2392-9].
“Techniques of Agreement, Diplomacy, Lying” (engl., überarbeitete Übers.), in: Brendan Moran and Carlo Salzani (Hgg.): Towards the Critique of Violence: Walter Benjamin and Giorgio Agamben, London & New York: Bloomsbury Academic (Bloomsbury Studies in Continental Philosophy), 2015, 19-37.
„Der Einfall des (vielleicht) „ungeheuersten Witzes““, in Akzente: Witz, hgg. von Monika Rinck, Jo Lendle, München Hanser-Verlag 4/ Dez. 2015, 62. Jg., 57-65.
Publikationen bis 2020
„im auftreten /verschwinden – auf dem Schauplatz und anderswo“, in Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung (ZMK): Themenheft „Verschwinden“, Frühjahr 7/1 (2016), 185-200.
„Allegorie. ‚Ostentation der Faktur’ und ‚Theorie’. Einleitung“ (zu Sekt. II), in: Allegorie (DFG Internationales Symposium), hgg. von Ulla Haselstein unter Mitarbeit von Friedrich Teja Bach, Bettine Menke, Daniel Selden, Tübingen: De Gruyter, 2016, 113-135.
„Wort-Blüten“, in: Isabel Kranz, Alexander Schwan, Eike Wittrock (Hg.), Floriographie: Die Sprachen der Blumen, München: Fink, 2016, 63-92 [ISBN 978-3-7705-5994-7].
„Das Martyrium der Zeichen. Evidenzstrategien am stigmatisierten Körper, Regularien und Exzess der Körperzeichen“, in: Vollstes Verständnis. Utopien der Kommunikation, hg. von Claus Pias und Stefan Rieger, Berlin: diaphanes (sequenzia), 2016, 73-88 (ISBN: 9783037346310).
„Reyen“, für Gryphius-Handbuch, hg. von Nicola Kaminski, Robert Schütze, Berlin/ Boston: de Gruyter 2016, 692-709.
„‚Katastrophen‘ der Spektakel – aus den Theater-Maschinen“, www.uni-erfurt.de/fileadmin/public-docs/Literaturwissenschaft/avl/Menke/Bettine_Menke_Katastrophen_Nov_2016.pdf
„Goldauflösungen – zum Windei des Wortspiels“, in: Ute Holl, Claus Pias, Burkhardt Wolf (Hg.): Gespenster des Wissens, Zürich-Berlin 2017, 247-251. [ISBN: 978-3-0358-0065-4]
Bettine Menkeová: “Ve vystupování (a mizezení) – na jevišti a mimo něj” (tschechische Fassung von „im auftreten (verschwinden) – auf dem Schauplatz und anderswo“), in Katerina Krtilova, Katerina Svatonova (Hgg.): Mizení. Fenomény, meiální praktiky a techniky na prahu zjeného, Prag: Karolinum 2017, 125-151.
„‚Grund’ und ‚parerga’. Der Chor“, in: Forum Modernes Theater Heft 1/ 2013 Bd. 28: kollektiv auftreten, hgg. von Evelyn Annuss, (double blind peer review) Tübingen: Narr-Verlag 2017, 11-24.
„Was das Theater möglich macht: Theater-Maschinen“, in Archäologie der Spezialeffekte, hgg. von Natascha Adamowsky, Nicola Gess u.a., München (Fink: eikones), 2018, 113-144 [Aug. 2023 auch OA freigeschaltet].
„Spectacles of ‘Catastrophe’, made by Theatrical Machines – and their destruction“, in: Catastrophe & Spectacle. Variations of a Conceptual Relation from the 17th to the 21st Century, hgg. von Jörg Dünne, Gesine Hindemith, Judith Kasper, Berlin: Neofelis Verlag 2018 [ISBN: 978-3-95808-122-2], 26-39.
Zus. mit Juliane Vogel: „Das Theater als transitorischer Raum. Einleitende Bemerkungen zum Verhältnis von Flucht und Szene“, in: Flucht und Szene. Perspektiven und Formen eines Theaters der Fliehenden, hgg. von B. Menke, J. Vogel, Berlin (Mai) 2018 (peer reviewed) [ISBN 978-3-95749-119-0], 7-23.
„Agon und Theater. Fluchtwege: die Sch(n)eidung und die Szene, … zu und nach den aitiologischen Fiktionen F.C. Rangs und W. Benjamins“, in Flucht und Szene. Perspektiven und Formen eines Theaters der Fliehenden, hgg. von B. Menke, J. Vogel, Berlin (Mai) 2018 (peer reviewed) [ISBN 978-3-95749-119-0], 203-241.
„Negative Beispiele Geben. Eine Lektüre von Kleists „Allerneuester Erziehungsplan“, in: Negativität. Kunst – Recht – Politik, hg. von Thomas Khurana, Dirk Quadflieg, Francesca Raimondi, Juliane Rebentisch, Dirk Setton, Berlin: Suhrkamp stw 2267, 2018 [ISBN 978-3-518-29867-1]. 132-146.
„Kafkas Zerstreuungen“ in: Franz Kafka im interkulturellen Kontext , hgg. von Stefan Höhne/ Manfred Weinberg, Weimar & Köln: Böhlau 2019, 229-262.
„Torheiten“, in: Universalenzyklopädie der menschlichen Klugheit, Festschrift für Bernhard Siegert, hgg. von Markus Krajewski, Harun Maye, Berlin: Kulturverlag Kadmos 2020, 248-250 [ISBN 978-3-86599-449-3].
„Buchstaben-Alchimie oder der Witz der buchstäblichen Spiele. Kombinationen und Effekte“, in JJPG Jg. 54 (2019), hg. von Ralf Simon (Alchemie und magia naturalis), 57-81.
III. Publikationen: Beiträge, Artikel in Zeitschriften, Handbüchern und Sammelbänden
Publikationen seit 2020
„Gesture and Citability: Theater as Critical Praxis“, in: Beate Söntgen et al. (Hg.), Critical Stances. The Stakes of Form, Berlin: Diaphanes 2020, 261-295 [deutsche Fass. „Geste und Zitierbarkeit, der Anhalt der Kritik und Theater als kritische Praxis“, auf: www.uni-erfurt.de/philosophische-fakultaet/seminare-professuren/literaturwissenschaft/professuren/allgemeine-und-vergleichende-literaturwissenschaft/lehrende/prof-dr-bettine-menke: Vorabveröffentlichungen].
“Writing-out: Gathered up at a Venture from All Four Corners of the Earth. Jean Paul’s Techniques and Operations (on Excerpts)”, in: Jörg Dünne, Kathrin Fehringer, Kristina Kuhn, Wolfgang Struck (ed.), Cultural Techniques: Assembling Spaces, Texts & Collectives, de Gruyter, 2020, 219-241 [deutsche Fass. „Aus-Schreiben – aus allen vier Enden der Welt auf gut Glück zusammengetrieben. Jean Pauls Techniken und Operationen (über Exzerpte)“, auf: www.uni-erfurt.de/philosophische-fakultaet/seminare-professuren/literaturwissenschaft/professuren/allgemeine-und-vergleichende-literaturwissenschaft/lehrende/prof-dr-bettine-menke: Vorabveröffentlichungen]
„trompe l’œil: Mosaik und Auskehricht“, in: Exzessive Mimesis. Trompe-l’œil und andere Überschreitungen der ästhetischen Grenze, hgg. von Helga Lutz und Bernhard Siegert, München: edition metzel, 2020, 29-38.
„Babel-Babbeln“, in wespennest. Zeitschrift für brauchbare Texte und Bilder. Nr. 179: Viele Sprachen – eine Sprache? Wien, Nov. 2020 [ISBN 978-3-85458-179-6], 73-76. [Zeichenzahl: 22.200]
„Heinrich von Kleist‘s „Anekdote aus dem letzten Kriege“: w-hole, the joke an anecdote (nearly) made“, in: Exemplary Singularity: Faultlines of the Anecdotal , hgg. von Mary-Ann Snyder-Körber mit James Dorson, Florian Sedlmeier, Birte Wege, De Gruyter: Anglia, 2020 (Jan. 2021) [ISBN 978-3-11-062953-8], 85-109.
„Theater as Critical Praxis: Interruption and Citability“, in: Poetic Critique, hgg. von Michael Chaouli, Jan Lietz, Jutta Müller-Tamm, Simon Schleusener, Berlin/ Boston: De Gruyter, 2021, 125-143.
„‘Para una crítica de la violencia’: Técnicas del acuerdo, diplomacia, mentira”, in: Horst Nitschack, Miguel Vatter (Hg.): Esperanza, pero no para nosotros. Capitalismo, técnica y estética en W. Benjamin, Santiago de Chile: LOM ediciónes 2021, 89-112.
„Maschine und Melodram. Wie Tiecks Der gestiefelte Kater das Theater vorführt“, in: Theatermaschinen – Maschinentheater. Von Mechaniken, Machinationen und Spektakeln, hgg. von Bettine Menke und Wolfgang Struck, transcript Verlag Bielefeld, Nov. 2022, 231-257 [ISBN print: 978-3-8376-5314-4; pdf: 978-3-8376-5314-8], zugleich OA (https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/42/12/33/oa9783839453148.pdf).
Bettine Menke, Wolfgang Struck, „Theater-Maschinen/Maschinen-Theater: Einleitung“, in dies. (Hg.): Theatermaschinen – Maschinentheater. Von Mechaniken, Machinationen und Spektakeln, transcript Verlag Bielefeld, Nov. 2022, 7-18 [ISBN print: 978-3-8376-5314-4; pdf: 978-3-8376-5314-8]/ zugleich OA (https://www.transcript-verlag.de/media/pdf/42/12/33/oa9783839453148.pdf).
„Reyen“, für Gryphius-Handbuch, hg. von Nicola Kaminski, Robert Schütze, Berlin/ Boston: de Gruyter 2016, 692-709 [Dez. 2022 neu als Broschur ISBN 9783111130262,
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110229448/html?lang=de].
„Die Rechts-Ausnahme des Flüchtlings, Symptome der ‚Menschenrechte‘“, in: Sigrid Köhler, Matthias Schaffrick (Hg.), Wie kommen die Rechte des Menschen in die Welt? Zur Aushandlung und Vermittlung von Menschenrechten, Winter Verlg. Heidelberg 2022 [in: Reihe Siegen „Beiträge zur Literatur-, Sprach- und Medienwissenschaft“], 179-211 [ISBN: 978-3-8253-4834-2].[Seit April 2019 vorab auf www.uni-erfurt.de/philosophische-fakultaet/seminare-professuren/literaturwissenschaft/professuren/allgemeine-und-vergleichende-literaturwissenschaft/lehrende/prof-dr-bettine-menke: Vorabveröffentlichungen].
„Niemandsland der ‚Flüchtlinge‘ – Theater und Politik der Hinzukommenden“, in: Auftrittsmöglichkeiten. Aspekte eines ‚postinklusiven‘ Theaters, hgg. von Tobias Funke, Mirjam Groll, Philipp Just, Sophia Koutrakos, Martin Jörg Schäfer, Thewis (Online Zeitschrift der Gesellschaft für Theaterwissenschaften) Jg. 2022/ Vol. 10, Ausg. 2 (Dez. 2022), 28-59. Abzurufen unter: https://www.thewis.de/issue/view/3.
„Figuration, ‚Gegenwart‘ in Suspendierung, auf dem Theater: ankommend und vorübergehend“, in: Figur(ation)en der Gegenwart, hgg. von Giuseppina Cimmino, Natalie Dederichs, Dana Steglich, Eva Stubenrauch, Wehrhahn Verlag: Hannover (Gegenwart | Literatur Bd. 4), 2023, 275-295 [ISBN 978-3-86525-979-0].
„Der komische Chor – das Chorische der ‚komischen Person‘“, in: The Germanic Review: Literature, Culture, Theory, 98:2; Choral Figurations, Guest editors: Evelyn Annuss, Sebastian Kirsch, Fatima Naqvi, 2023, 170-183 [DOI: 10.1080/00168890.2023.2199913; doi.org/10.1080/00168890.2023.2199913].
„Die Fliege auf dem Bord. Ins Bild kommen ...“, in: Ins Bild kommen – Spielräume der Kunstkritik, hgg. von Anita Hosseini, Anna Kipke, Holger Kuhn, Mimmi Woisnitza, München: Brill/Fink 2023 [ISBN: 978-3-7705-6799-7], 193-197.
im Druck:
Der „Donnerkeil“ und die „Kunstgriffe“ im Fortgang des Redens: Heinrich von Kleists Über die allmählige Verfertigung der Gedanken beim Reden, Beitrag für „Rhetorik und Romantik“, Schwerpunkt Band 42 (2023) des Internationalen Jahrbuchs für Rhetorik, hgg. von Andrea Allerkamp, Sebastian Schönbeck.
„Lesen – Wiederholen – Übersetzen (Schleiermacher bis Gardi u.a.)“, für: Literarische Texte lesen – Texte literarisch lesen, Festschrift für Cornelia Rosebrock, hgg. von Mark-Oliver Carl, Moritz Jörgens, Tina Schulze, Springer Berlin, 12/2023 [ISBN-13: 9783662678152].
Publikationen als pdf
Publikationen als pdf
- Aufgegebene Lektüre. Kafkas ‘Der Bau’, in: Die Aufgabe des Lesers (hg. v. Ludo Verbeek u. Bart Philipsen), Verlag Peters, Leuven, 1992, 147 - 175.
- Sturm der Bilder und zauberische Zeichen. Kleists „Die Heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik.(Eine Legende)“, in: H. Birus, R. Warning (Hg.), „Germanistik und Komparatistik“ (hg. v. (DFG-Symposion 1993), Stuttgart (Metzler) 1995, 209-245.
- „Rhetorik der Echo. Echo-Trope, Figur des Nachlebens“, in: Weibliche Rhetorik - Rhetorik der Weib-lichkeit, hg. v. Dörte Bischof, Martina Wagner-Egelhaff, Freiburg: Rombach 2003, 135-159.
- - / Dietmar Schmidt: „Ritual im Aufschub. Gottesgericht, Ehrenhandel und literarische Performanz bei Kleist, Conrad und Puschkin“, in: Das Gedächtnis des Gedächtnisses. Zur Präsenz von Ritualen in beschreibenden und reflektierenden Texten, hg. v. B. Kranemann, J. Rüpke, Marburg: diagonal-Verlag 2003, 103-155.
- - , Dietmar Schmidt, „Am Nullpunkt des Rituals. Darstellung und Aufschub des Zweikampfs bei Kleist, Conrad und Puschkin“, in: Arcadia Bd. 40 (2005), 194-236.
- „Exzeß der Performanz – Interventionen der/ in die Schrift. Kleists Witz“, in: Die Szene der Gewalt. Bilder, Codes und Materialitäten, hgg. von D. Tyradellis, B. Wolf, Frankfurt a. M., Berlin, Bern, New York, Oxford, Wien 2007, 141-156.
- „Die Gewalt einer Mitteilung, die ver-rückt“. Über Medien von Religion in Heinrich von Kleists ‚Die Heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik. Eine Legende’ (1811), in: Religion in den Medien - Medien der Religion, hg. von J. Malik, J. Rüpke, T. Wobbe, Münster: Aschendorff, 2007, 131-151 u. 228-237.
- „Ein-Fälle aus Exzerpten. Die inventio des Jean Paul“, in: Rhetorik als kulturelle Praxis, hg. von R. Lachmann, R. Nicolosi, S. Strätling, München (Fink), 2008, 291-307.
- Alphabetisierung. Kombinatorik und Kontingenz, Jean Pauls Leben Fibels, des Verfassers der Bienrodischen Fibel, in: ZMK (Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung) 2/ 2010 (F. Meiner Verlag), 43-59.
- „Respondance: Das der Rede eingeschriebene Andere, die Echoräume der Rede (mit Ovids Echo)“, on-line Publikation der Tagung Die Praxis der/des Echo (Institut für Theaterwissenschaft Leip-zig Febr. 2013): http://konferenz.uni-leipzig.de/echo2013/projekt/publikationen/beitraege/menke/
- mit Thomas Glaser: „Experimentalanordnungen der Bildung: Exteriorität – Theatralität – Literarizität. Ein Aufriss“, in dies. (Hgg.): Experimentalanordnungen der Bildung: Exteriorität - Theatralität – Literarizität, München: Fink, 2014, 7-21. Titelbild Inhaltsverzeichnis Klappentext
Vorabveröffentlichungen
Vorabveröffentlichungen
- Geste und Zitierbarkeit, der Anhalt der Kritik. Theater als ‚kritische Praxis‘. (Berlin, diaphanes, 2019/2020)
- Die Rechts-Ausnahme des Flüchtlings, Symptome der ‚Menschenrechte‘ in: Sigrid Köhler, Matthias Schaffrick (Hg.), Wie kommen die Menschenrechte in die Welt?, in: Siegener Reihe „Beiträge zu Literatur-, Sprach- und Medienwissenschaft“, 2019 (Druck in Vorbereitung).
- Aus-Schreiben – Aus allen vier Enden der Welt auf gut Glück zusammengetrieben. Jean Pauls Techniken und Operationen (über Exzerpte) in: Jörg Dünne, Kathrin Fehringer, Kristina Kuhn, Wolfgang Struck (Hg.). Cultural Techniques: Assembling Spaces, Texts & Collectives. Berlin/New York: De Gruyter, 2020.
- „‚Katastrophen‘ der Spektakel – aus den Theater-Maschinen“
Tagungen/ Drittmittel
Tagungen und Workshops (Planung & Organisation):
· Theater/Maschinen: Tagung org. zus. mit W. Struck, 4. – 6. Juli 2019, Forschungsbibliothek Gotha (Tag. Und Publ. finanziert durch die Thyssen-Stiftung).
· Flucht und Szene. Perspektiven und Formen eines Theaters der Fliehenden, Tagung org. von Bettine Menke, Juliane Vogel, Konstanz Juli 2016 (finanziert von Exzelenzcl. 16 der Univ. Konstanz).
· Leitung der 2. Sektion des Internationalen literaturwissenschaftlichen DFG-Symposion „Allegorie“ (org. von U. Haselstein, mit T. Bach, B. Menke, D. Selden), 19.-23. Mai 2014, Villa Vigoni. (Tagung und Publikation finanziert von DFG.)
· Panel: theories of media (zus. mit D. Schöttker), Biennial Conference der International Walter Benjamin Society: Schrift. Writing and Image-Chracter in the Work of Walter Benjamin, Princeton 2.-5. Nov. 2011.
· Experimentalanordnungen der Bildung, Tagung Erfurt 23.-25. Juni 2011, konzipiert und org. mit Thomas Glaser u.a., mit dem Forum Texte. Zeichen. Medien, (Tagung und Band gefördert durch VW-Stiftung).
· Das Melodram: ein Medienbastard, Tagung Erfurt 2-4. Juni 2011, konzipiert u. org. mit A. Schäfer u. Daniel Eschkötter (getragen vom DFG-Graduiertenkolleg „Mediale Historiographie“).
· Panel: „Synkretismus“ der Internationalen Tagung Wissen von Religion, Erfurt 23.-25. Sept. 2010.
· Panel: Buchstabentreue für die Internationale Tagung der W. Benjamin Association: „Walter Benjamins ‚Treue’ – true to Benjamin“, 14. -17. Sept. 2009, Antwerpen.
Wieland/ Übersetzungen. Internationale Tagung, konzipiert und org. mit W. Struck, Erfurt u. Oßmannstedt 26.- 28. Juni 2008 (gefördert durch DFG).
· Panel: Akustische Figuren: Stimmen und Geräusche / Acoustical Figures: Voices and Noises (zus. mit U. Wirth, ZFL), NOW. Internationales Benjamin-Festival, Berlin 17. – 21. Okt. 2006.
· Tragödie. Trauerspiel. Spektakel, Tagung org. zus. mit C. Menke 16./17. Dez. 2005 im Roten Salon der Volksbühne (Berlin) (in Zusammenarbeit des GK „Mediale Historiographien“ und SFB „Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste“, Berlin).
· Witz, Rhetorik und Performanz, (Workshop) Erfurt Nov. 2004.
· Literatur und Philosophie, Tagung 17. / 18. Juli 2003, im Literaturhaus Fasanenstraße, Berlin, org. mit E. Horn (getragen vom DFG-GK: Repräsentation, Rhetorik. Wissen (Frankfurt/O).
· Evidenz als Verfahren, DFG-Rundgespräch, 23.-25.05.2002 in Erfurt (finanziert durch DFG).
· Die Bühne der Kastraten, in Zusammenarbeit mit G. Brandstetter (Basel), Erfurt 14.-16. Dez. 2001 (gefördert aus Mitteln des Landes Thüringen).
· Manier, Manieren, Manierismen. Tagung, konzipiert u. org. mit E. Greber (München) in Konstanz 9./10. Nov. 2001 (getragen durch SFB Literarische Anthropologie, Univ. Konstanz).
· Stigmata. Körperinschriften, Internationale Tagung, konzipiert mit B. Vinken, Warburg-Haus Hamburg 06.-08.12.2000.
· Kritik der Gewalt - Homo sacer. Workshop Erfurt 16./17.11.2000, in Zusammenarbeit mit dem DFG-Graduiertenkolleg Frankfurt (Oder) u. Poetic’s Institute New York (NYU).
Forschung
Forschungskooperationen
Forschungskooperationen
Zu den aktuellen Forschungsprojekten der Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft an der Universität Erfurt führen Sie die folgenden Links:
Forum: "Texte. Zeichen. Medien."
Nachwuchskolleg Literaturwissenschaft: "Texte. Zeichen. Medien."
Forschungsschwerpunkte
Forschungsgruppe: Kulturtechniken des Sammelns (Univ. Erfurt, finanziert u.a. durch das Land Thüringen, Sprecher: W. Struck). [Link einfügen zur betreffenden homepage]
Nachwuchskolleg Texte. Zeichen. Medien, der Literaturwissenschaft an der Universität Erfurt (seit 10/2008, gegenw. ongoing; Sprecherin: 10/2008-9/2023, finanziert durch das EPPProgramm der Universität Erfurt). [Link einfügen zur betreffenden homepage]
DFG-Netzwerk Versammeln (bis Ende 2023), Sprecherin: J. Prager (TU Dresden). [Link einfügen zur betreffenden homepage]
Forschungsprojekt: Exophonie Leiterin J. Prager, TU Dresden (seit Okt. 2022)
Mediale Historiographien DFG-GK (2004-2014) (der Universitäten Weimar, Erfurt, Jena), (01/2005 – 09/2012 Stellvertretende Sprecherin, 10/2012 – 12/2013 Sprecherin des GRK) (Auslaufphase bis Ende 2014).
2008 – 2012: Forschungsteam „Übertragungen: Medien und Religion“ (Sprecherin) der Graduiertenschule „Religion in Modernisierungsprozessen“ (aus Proexzellenz-Mittel des Landes Thüringen, in Kooperation mit dem GK “Mediale Historiographien”)
IWBS (International Walter Benjamin Society) ongoing.
Forschungsfelder: Theorie der Literatur, Dekonstruktion, Lesen in Hinsichten von Rhetorik, Gedächtnis, gender studies und Politik.
Die Forschungen richten sich auf Verschränkungen von Rhetorik und Poetik des Wissens und Mediengeschichte
· in der Monographie „Prosopopoiia“ und einer Reihe von kleineren Arbeiten zur romantischen Akustik auf die Relation von literarischen Texten und analogen Medien, die Thematisierung eines ‚neuen‘ Mediums durch ein anderes (Schrift). Das Hauptaugenmerk lag auf der Rhetorik der Entrhetorisierung als kritischer Verhandlung von gängiger Mediengeschichtsschreibung.
· den Logiken der Darstellung, dem Verhältnis von Darstellung und historischem Wissen, d.i. der konstitutiven Funktion von Repräsentationsformen für Objekte kulturellen Wissens.
· Im Zusammenhang des GK Mediale Historiographie (2004-2014): die Gesichtspunkte Textualität der Geschichte mit und nach Walter Benjamin, Ablösung der Historiographie vom Primat der Erzählung durch die Diskontinuität der Geschichte, mit dem Verfahren der Zitation; die Eröffnung und Organisation von Zeit und Zeitlichkeit durch und in deren Figurationen (Allegorie, Zitat); die Kodierung historischer Zeit durch Prozesse des Erinnerns und deren intrinsischen Bezug auf das Vergessen, Konzepte des Gedächtnis‘ (Aktualisierung, Virtualität) und Speicherstrukturen; Formen von Referenzillusion, die Erzeugung von Effekten des Faktischen und der Evidenz in den Medien Schrift und Bild.
· Die Reichweite literarischer Lektüren für andere Zeichenordnungen, Darstellungsmodi und Medien. Dazu gehörte die Perspektive der Evidenz (u.a. DFG-Rundgespräch, Erfurt Mai 2002; sowie: Stigmata – Körperzeichen zwischen religiöser Einschreibung und medizinischer Diagnose gemeinsam mit B. Vinken (Hamburg) Tagung 2000 und Band), und die literarische Verhandlung von Exemplarizität (seit 2017, Publ. seit 2018).
Forschungsschwerpunkte
· Übersetzen, die Sprache des Anderen, Anderssprachigkeit.
· Theater und seine Medialität, dessen Kulturtechniken: Auftreten (und Abtreten), mit besonderer Fokussierung von Flucht und Szene.
· Theatralität und exzentrische Spielformen (das Komische)
· Lesen, Schrift, Schrift-Bildlichkeit und Spatialität der Schrift. Medien des Textes.
· Kulturtechniken, Operatoren der Texte, Ausschreiben u.ä..
· Der Witz und die Witze (wit and jokes): (2021 abgeschlossenes) Buch zum Witz der Sprache u. weitere Publikationen.
· Praktiken und Figurationen des Zitierens, Kommentierens und Exzerpierens
· Rhetorik und Dekonstruktion
· Die Stimme und die Schrift, Sound und Text
· Walter Benjamin in vielen Aspekten (Gerechtigkeit, Geschichtskonzept, Theaterbegriff, Übersetzen)
· Franz Kafka, Heinrich von Kleist (und weitere Autoren)
Weitere ältere Forschungsschwerpunkte:
- Prosopopoiia
- Semiologien des Körpers
- Literarische (Un)Ordnung der Geschlechter
- Kulturwisenschaftliche Perspektiven in der Literaturwissenschaft
- Gedächtnis der Texte
- Rhetorik
- Polarfahrten
Lehrveranstaltungen
Lehrveranstaltungen Archiv
Betreute wissenschaftliche Arbeiten
Betreute wissenschaftliche Arbeiten
Habilitationen:
· Armin Schäfer: Die Intensität der Form. Stefan Georges Lyrik (2003), Prof. für NDL an der FernUniversität Hagen, seit WiSe 2015/16 Prof. für NDL Ruhr-Universität Bochum
· Dietmar Schmidt: Repräsentationsformen des Animalischen im 19. Jahrhundert (05/2000 – 06/2006, Wiss. Mitarb. AVL; gegenwärtig Akademischer Rat (NDL) an der Universität Erfurt; 1 Kind)
· Martin Schäfer: Zu Faulheit und Muße (04/2006 – 11/2010, Wiss. Mitarb. AVL, zwischenzeitlich Vertretung einer Prof. an der Universität Siegen; danach: Heisenberg- Stipendium; seit 2015 Heisenberg-Professur NDL und Theaterwiss. Universität Hamburg)
· Ulisse Doga: Über die Armut im Geiste (01/2010 – 01/2015, seit 2016 Mitarbeiter der Italienischen Botschaft in Berlin)
· Annina Klappert: Lose Kopplungen. Virtualität als Risiko und Potential, Abschluß der Habilitation 11.5.2016 (Postdoc-Stip. „Forum: Texte. Zeichen. Medien“ 10/2008 – 04/2012; seit 05/2012 0,5 Wiss. Mitarb. AVL; 2 Kinder. Seit Okt. 2021 Akademische Rätin an der Universität Erlangen)
· Katrin Trüstedt: Literatur der Stellvertretung Abschluß der Habilitation 6.1. 2021 (10/2009 -06/2017 Junior-Prof. AVL Universität Erfurt; Herbst 2017 bis Juni 2021 Assistant Prof. at Yale Univ. New Haven, 1 Kind) seit August 2021 Forschungsstelle, Stellv. Direktorin am ZfL Berlin.
(Abschluß durch Antreten einer Professur: Helga Lutz: Oberflächen, Löcher und Falten (Arbeitstitel) (11/2009 ‒ 06/2014 Wiss. Mitarb. AVL; seit 07/2014 wiss. Mitarb. in der DFG-Forschergruppe „Medien und Mimesis“, Bauhaus-Universität Weimar; 2 Kinder), seit 2017 Professorin für Historische Bildwissenschaft/Kunstgeschichte der Universität Bielefeld)
Laufende Habilitation:
· Nils Plath: Schriftlandschaften (vor 1800, um 1928, nach 1960) (seit 10/2014, Wiss. Mitarb. AVL)
Promotionen (nur Erstbetreuung):
· Yanik Avila: Stereoskopische Bildlichkeit – Raum und Visualität in Walter Benjamins kritischer Geschichtsphilosophie (03/2011 – 03/2014, GRK „Mediale Historiographien“, sitd. versch. Unterrichtstätigkeiten, ab 04/2022 ½ wiss. Mitarb. AVL UE, 1 Kind), Abschluß 2023.
· Marlen Freimuth: Unheimliche Architekturen (seit 10/2011, Stip. „Forum: Texte. Zeichen. Medien“ bis 09/2014, berufl. Tätigk.). Abschluß Okt. 2022.
· Tobias Schmidt: Exzentrische Zeichen. Narben in Literatur, Film und Fotografie des 20. und 21. Jahrhunderts, Abschluss 20.10.2021, (10/2012 – 10/2015, Stip. „Forum: Texte. Zeichen. Medien“; 2 Kinder).
· Alexander Waszynski, Lesbarkeit nach Hans Blumenberg, Abschluß 15. Nov. 2018 (seit 09/2014 Stip. „Forum: Texte. Zeichen. Medien“, seit 2018 wiss Koordinator im SFB der TU Braunschweig, wiss. Mitarbeiter , i.V. an der RUB, seit Sommer 2021, wiss. Koordinator am SFB der Univ. Greifswald; 2 Kinder)
· Lucia Iacomella: Das Grauenhafte des bloß Schematischen: Franz Kafkas Ästhetik des Durchschnittsmenschen. Abschluß Disp. 2. Juni 2017 (10/2008, Stip. „Forum: Texte. Zeichen. Medien“ bis 09/2011, 1 Kind)
· Jana Mangold: Medien – Verhandlungen zu Grammatik und Rhetorik. Eine Archäologie der Medientheorie Marshall McLuhans (12/2008 ‒ 02/2016, Stip. Graduiertenschule „Religion in Modernisierungsprozessen“/GRK „Mediale Historiographien bis 6/2012; Lektoratstätigkeit; 2015-2018 0,5 Wiss. Mitarb. sowie WS 2018/2019 Vertretung der Juniorprofessur für Medienkulturwissenschaft am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaften, J.W. Goethe Universität Frankfurt am Main); seit 2018 wissenschaftliche Koordinatorin der Forschungsgruppe „Kulturtechniken“ an der Universität Erfurt (2 Kinder)
· Peter Schuck: Zombologie – Medien des Posthumanen (10/2010 ‒ 01/2015, Stip. „Forum: Texte. Zeichen. Medien“; bis 2021 Lehraufträge an der Universität Erfurt)
· Nils Plath: Hier und Anderswo. Zur Stellenlektüre (09/2009 – 11/2014, Stip. „Forum: Texte. Zeichen. Medien)
· Anika Höppner: Mediate/Immediate. Visionskultur im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (10/2008 – 11/2013, Graduiertenschule „Religion in Modernisierungsprozessen/GRK „Mediale Historiographien“; jetzt Wiss. Mitarb. (je 0,5): Sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte (Universität Erfurt)/DFG- Forschergruppe „Medien und Mimesis“ (Bauhaus-Universität Weimar); WiSe 2015/16 Vertretung der Jun.Prof. Mediale Historiographien an der Bauhaus-Universität Weimar; seit 2018 Forschungsreferentin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena (2 Kinder)
· Sabine Zubarik: Fußnotenromane (04/2006 – 12/2012, Studienstiftung d. dt. Volkes, Lehraufträge, Vertretungstellen; nach Abschluss: LfbA (u.a. Romanistik Universität Erlangen/Nürnberg; seit 01/2014 eigene Drittmittelstelle (DFG) an der Universität Erfurt.
· Anna Häusler: Zeit-Bilder. Strategien der Darstellung von Ereignis-Wissen bei Einar Schleef und Rainald Goetz (01/2008 ‒ 05/2011, GRK „Mediale Historiographien“; nach Abschluss: Postdoktorandin im „Forum: Texte. Zeichen. Medien“ (11/2011 ‒ 10/2013); 2013 ‒ 2015: 0,5 Wiss. Mitarb. NDL Univ. Erfurt; seit 08/2015: Wiss. Mitarb. am Lehrstuhl von Prof. Dr. Lars Koch für Medienwissenschaft und Neuere deutsche Literatur, TU Dresden.
· Thomas Glaser: Grund-Risse der Verständlichkeit um 1800. Modellierungen ästhetischer Mitteilung zwischen dynamistischer Mechanik und algebraischer Analysis (Abschluss 2010); mit dem Projekt „Ästhetische Bildung“ seit 11/2010 Postdoktorand im „Forum: Texte. Zeichen. Medien“; zwischenzeitlich 0,5 Mitarb. NDL Universität Erfurt; seit 10/2013 Verwalter des Ls. Rhetorik im Innovations-Inkubator der Leuphana Universität Lüneburg; seit 10/2015 0,5 Wiss. Mitarb., jetzt LfbA Stelle, NDL Universität Erfurt.
· Thorsten Bothe: Rhetorik des Beispiels – Beispielhaftigkeit der Rhetorik. Memoria als Kulturhermeneutik (01/2005 – 03/2009, GRK „Mediale Historiographien“; nach Abschluss: Anschubfinanzierung des GRK; seit 2011 am Innovations-Inkubator der Leuphana Universität Lüneburg; seit 10/2015 Wiss. Mitarb. an der RWTH Aachen.
· Isabel Kranz: Raumgewordene Vergangenheit (01/2005 – 05/2009, GRK „Mediale Historiographien“). Danach Wiss. Koordinatorin des GK Mediale Historiographien (Erfurt), mit dem Projekt „Sprache der Blumen“ seit 07/2014 Postdoc-Stelle am GK „Funktionen des Literarischen in Prozessen der Globalisierung“, LMU München, seit 2017 DFG Drittmittelstelle an der Universität Wien, Ls. Vertretungen, 2 Kinder.
· Silke Herrmann: Kastraten-Performance. Performativität und Theatralität (in) der Literatur und Barockoper (Abschluss 09/2008); Zweites Staatsexamen in Hamburg, Lehrerin.
· Jörn Etzold: „Zeit und Gesellschaft bei Guy Debord“ (06/2006, (GRK „Mediale Historiographien“; danach selbst eingeworbene Drittmittelstelle (Theaterwissenschaften Universität Bochum); Wiss. Mitarb. Theaterwissenschaft J.W. Goethe Universität Frankfurt am Main; Humboldtstipendium 2015; seit 2018 Prof. der Theaterwissenschaft an der RUB.
· Evelyn Annuß: „Elfriede Jelineks Theater des Nachlebens“ (12/2004; danach Projekte im Bereich der bilden Kunst u. Fotografie; seit 2011 selbsteingeworbene Drittmittelstelle (Theaterwissenschaften Universität Bochum); Abschluss der Habilitation 01/2016; Vertretungsprofessur Theaterwissenschaften LMU München, seit 2019 Professorin an der mdw Wien.
· Julika Funk: Romantische Verwirrung der Geschlechter. Zum Geschlechterdispositiv in romantischen Texten (10/2002; Beschäftigungen im Bereich der Wissenschaftsverwaltung)
Laufende Promotionen:
· Samuel Kpodo: Schreibprozess bei Roland Barthes (Stip. der Konrad Adenauer Stift. seit Juni 2020)
· Tobias Funke: Verletzende Sprache im Theater (Kunstfreiheit als „moralisches“ Problem im 21. Jahrhundert) (Stip. des NwK TZM seit Jan 2021)
· Mattias Engling: Groteske Macht und widerständiger Humor. Verfahren subversiver Affirmation auf der politischen Bühne (Stip. des NwK TZM seit Jan 2021)
· Hui Ye: Die Struktur der Großstadt-Wahrnehmung und deren Verfahren in Robert Walsers Berliner Trilogie: „Geschwister Tanner“ (1907), „Der Gehülfe“ (1908), „Jakob von Gunten“ (1909). (angenommen 2021)
· Jannick Popelka: zoon logon euchomenon. Eine Untersuchung zum Modus einer Sprache der Politik (angen. 2022).
· Rujia Guo: „Die rhetorische Subjektivität im Politischen in Bezug auf den Hegemonie-Begriff von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe“ (angenommen März 2023)
· Mirijam Habel: „Heldin und Autorin. Zu Charlotte Schillers literarischen Texten“.
· Friederike Thielmann: „Die Figur der Leiche. Theater der Auferstehung“ (seit 10/2010, Stip. Graduiertenschule „Religion in Modernisierungsprozessen“/GRK „Mediale Historiographien“ bis 2014; 2 Kinder; seit WiSe 2014/15 0,5 Wiss. Mitarb. an der HfMDK Frankfurt am Main)
· Karin Kröger: „Schrift, Literatur und Mathematik“ (Arbeitstitel) (seit 2011 GRK „Mediale Historiographien“, div. DAAD-Stipendien für Forschungsaufenthalte im Ausland bis 07/2014; z.Zt. Vertr. 0,5 Wiss. Mitarb. Sammlungsbezogene Wissens- und Kulturgeschichte, Universität Erfurt), zwischenzeitlich 2 Kinder.